UdSSR/Kommunistische Besatzung
IV Die sowjetische Besatzung und der Kalte Krieg
Im Jahr 1940 hörte der unabhängige Staat Lettland aufgrund der Besetzung und Annexion Lettlands durch die Sowjetunion und der Eingliederung in die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) auf zu existieren.
Alle Institutionen, die die Souveränität des Staates sicherten, einschließlich des Außenministeriums, der Streitkräfte und des Grenzschutzes, wurden aufgelöst. Die lettischen Vertretungen im Ausland wurden aufgelöst, ihre Gebäude und ihr Eigentum von der UdSSR übernommen. Die Armee und der Grenzschutz wurden verkleinert, die Offiziere und Kommandeure wurden ersetzt.
Die sowjetische Besatzung dauerte bis 1991.
Während der Besatzung fanden zwei Massendeportationen der lettischen Bevölkerung statt, eine 1941 und eine 1949, bei denen die Bevölkerung neben den durchgeführten Währungsreformen auch Repressionen und Propaganda ausgesetzt war.
Weitere Informationsquellen
1. Sowjetische Besatzung – Lettisches Besatzungsmuseum (okupacijasmuzejs.lv)
2. Sowjetische Besatzung – Lettisches Besatzungsmuseum (okupacijasmuzejs.lv)
Ihre Kommentare
Guten Tag! Danke für deinen Kommentar! Solche Tatsachen wurden in historischen Quellen erwähnt, die von Experten auf dem betreffenden Gebiet erstellt wurden. Sollten Ihnen weitere Zahlen und Fakten zum genannten Thema vorliegen, teilen Sie uns diese bitte unter Angabe der Quelle mit. Mit freundlichen Grüßen „Landreisender“
Darüber hinaus machten sowjetische Flugzeuge gelegentlich Fehler, indem sie Bomben und Raketen außerhalb des Testgeländes abwarfen. So fielen beispielsweise im Jahr 1967 drei Bomben in Saldus. Auch in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre kam es weiterhin zu Zwischenfällen. Durch die Druckwellen tieffliegender Flugzeuge gingen an der Saldus Secondary School wiederholt Fenster zu Bruch. Erst mit dem Abzug der russischen Armee im Jahr 1993 konnte die Deponie beseitigt werden. Gleichzeitig wurde auch die Gemeinde Zvārde neu gegründet, die heute in der Region Saldus liegt. Aus den von der Lettischen Gesellschaft für Besatzungsforschung zusammengestellten Archivdaten geht hervor, dass während der sowjetischen Besatzung auf dem Gebiet der Lettischen SSR insgesamt 163.856 Hektar Land (ohne Städte) für die Bedürfnisse der sowjetischen Armee bereitgestellt und 1.335 Bauernhöfe auf diesem Land liquidiert wurden. lasi.lv Viesturs Sprūde, Lilija Limane / Latvijas Avīze
Zugehörige Zeitleiste
Zugehörige Objekte
Turm zur Ausrichtung des Artilleriefeuers der 46. Küstenbatterie Ventspils
Der hergerichtete Turm zur Ausrichtung des Artilleriefeuers der 46. Küstenbatterie Ventspils liegt an der Saulrieta iela und ist heute als Aussichtsturm öffentlich zugänglich. Der Turm mit seinen danebenliegenden vier Geschützstellungen ist die einzige so gut erhaltene Küstenbatterie aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges in Lettland. Besucher gelangen über eine Treppe im Turm zu einer offenen Aussichtsplattform mit Blick aufs Meer. Die neben dem Turm aufgestellte Schautafel enthält neben anderen Informationen einen QR-Code, über den eine Animation über die Geschichte des Ortes abrufbar ist. Am Turm sind eine neue Straße und ein großer Parkplatz angelegt worden. Holzstege führen in das hier anschließende Naturschutzgebiet.
Dieses Militärobjekt entstand 1939 im Rahmen des Aufbaus sowjetischer Militärstützpunkte in Lettland. Die 46. Küstenbatterie verfügte unter anderem über vier B-13 Küstenartilleriestellungen. Ihre Feuertaufe kam, als am 24. Juni 1941 deutsche Torpedoboote den Hafen von Ventspils angriffen. Sie konnten durch Gegenfeuer der Batterie von diesem Küstenabschnitt vertrieben werden. Am 28. Juni sprengte die sowjetische Armee selbst dien Küstenartilleriegeschütze und flieh.
Zvaigznīte - Militärische Gebäude in Irbene
Das 200 Hektar große Gelände war einst eine streng geheime Militärbasis, die von der Militäreinheit 51429 genutzt wurde.
Olmaņi-Batterie Nr. 456 (sowjetischer Militärstützpunkt "Krasnoflotska")
Die ersten Küstenschutzbatterien zur Verteidigung der Irbe-Straße wurden ab 1912 gebaut, als der Plan für die Minen-Artillerie-Stellungen der Baltischen Flotte genehmigt wurde, der mehrere Küstenschutzbatterien und Seeminenverlegungsstifte vorsah.
Die Stellung in der Straße von Irbe war die am weitesten südlich gelegene und hatte die Aufgabe, jeden feindlichen Zugang zum Rigaer Meerbusen zu blockieren. Das Hauptaugenmerk lag auf den Seeminen, von denen während des Ersten Weltkriegs Zehntausende von Schiffen der Baltischen Flotte in der Irbe-Straße verlegt wurden. Erst 1916 wurde mit dem Bau von Küstenschutzbatterien an der Südspitze der Insel Saaremaa, dem Kap Sirves, begonnen. Insgesamt wurden sieben Batterien gebaut, wobei die Batterie 43 mit 305-mm-Geschützen ausgestattet war. An der lettischen Küste der Meerenge von Irbe wurden keine Verteidigungsbatterien gebaut.
Wachturm des sowjetischen Grenzschutzes – heute Aussichtsturm Pāvilosta
Der Wachturm des sowjetischen Grenzschutzes liegt an der südlichen Mole von Pāvilosta. Der ehemalige Beobachtungsturm des sowjetischen Grenzschutzes, der seit Anfang der 1990er Jahre nicht mehr genutzt wird, verfügt heute über eine Aussichtsplattform mit einem um 360 Grad drehbaren Fernrohr. Von hier aus bietet sich ein schöner Blick auf das Meer und die Schiffe. Auch lassen sich von hier aus gut Vögel beobachten. Der Turm ist nur im Sommer und nur bei Tageslicht geöffnet. Das Betreten erfolgt auf eigene Gefahr, insbesondere in Anbetracht der steilen Treppe. Der Turm und seine Umgebung sind videoüberwacht. Im Winter ist er nicht zugänglich.
Ausstellung sowjetischer Militärfahrzeuge
Edgars Kārklevalks, der Gastgeber des Ferienhofes „Pūpoli“ im Kreis Dundaga, bietet bereits seit mehr als 15 Jahren militärhistorische Erkundungstouren zu ehemaligen Militärobjekten in Nordkurland an – mit seinem selbst wiederaufgebauten sowjetischen Militär-LKW GAZ-66 (für bis zu 24 Personen) und dem Militär-Jeep UAZ-3151 (für bis zu 6 Personen). Auf dem Gelände des Ferienhofes sind Fahrzeuge der Sowjetarmee und andere Technik zu sehen.
Beobachtungsturm der Sowjetarmee (Kurgan der Offiziere)
Der "Offizierskurgan" befindet sich weniger als einen Kilometer von den Ruinen der Zvārde-Kirche entfernt. Der Kurgan besteht aus den Ruinen und Überresten der umliegenden Häuser und des Gutshofs, die zusammengeschoben wurden. Auf dem Kurgan wurde ein Aussichtsturm errichtet. Laut Inschrift wurde der heutige Turm 1981 errichtet. Der Turm diente der Erfassung von Bombentreffern. Die Übungsbomben hatten einen geringeren Sprengstoffgehalt, so dass ihre Treffer sorgfältiger beobachtet werden mussten. Nicht explodierte Bomben wurden sofort neutralisiert, aber nicht alle konnten gefunden werden.
Die Überreste des Turms sind heute hier zu sehen - die Backsteinmauern. Da die Sperrmauer relativ hoch liegt, kann man an einem klaren Tag sogar die litauische Ölraffinerie in Mažeikiai sehen.
Geheimer sowjetischer Atombunker in Līgatne
Der geheime sowjetische Bunker liegt in der Gemeinde Līgatne in der Region Cēsis etwa 9 m unter dem Gebäude des Rehabilitationszentrums „Līgatne“ und dem angrenzenden Gelände. Der Bunker ist im Rahmen von Führungen öffentlich zugänglich und bietet Auftafeln in der Bunkerkantine und Feiern im sowjetischen Stil sowie das Reality-Spiel „OBJECT-X“. Der Bunker sollte im Falle eines Atomkrieges die Mindestvoraussetzungen für eine langfristige Handlungsfähigkeit des Ministerrates, der Führung des Kommunistischen Rates sowie der Führungsebene der Staatsplan-Komitees der Lettischen SSR schaffen. Die 2000 m2 große unterirdische Bunkeranlage bildete die leistungsfähigste autonome Infrastruktur mit allen notwendigen und modernen technischen Ausstattungen der damaligen Zeit. Der Bunker war einer der strategisch wichtigsten Orte in Sowjetlettland im Falle eines Atomkrieges. Die unterirdische Anlage umfasst einen geschützten Arbeitsraum, einen Schlafsaal mit 250 Betten, Hilfseinrichtungen sowie ein oberirdisches Wohngebäude mit 24 Wohnungen für das Servicepersonal. Alle authentischen unterirdischen Anlagen und Pläne sind erhalten geblieben. Zu sehen sind die autonome Kraftstation mit Dieselgeneratoren und Treibstoffdepot, Klimaanlagen zur Luftreinigung mit Sauerstoffreserven, Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen, die wie in einem U-Boot funktionierten, eine Telekommunikationseinheit, die eine direkte Verbindung mit Moskau - dem Kreml - und eine autonome Kommunikation mit allen wichtigen staatlichen Stellen des Landes ermöglichte, eine seltene Karte mit früheren Namen der Kolchosen, die originale Kantine mit typisch sowjetischer Speisekarte, verschiedene Sachen aus der Sowjetzeit und Haushaltsgegenstände.
Sowjetischer Raketenstützpunkt in Zeltiņi
Die ehemalige Raketenbasis der Sowjetarmee befindet sich in „Medņukalni“ in der Gemeinde Zeltiņi, Region Alūksne. Von 1961 bis 1989 gab es in Zeltiņi, im damaligen Rayon Alūksne, eine streng geheime sowjetische Militäreinrichtung - einen Atomraketenstützpunkt. Hier waren ballistische Mittelstreckenraketen (Boden-Boden-Raketen) vom Typ P-12 (8K63) und P12Y (8K63Y) stationiert, für die es 4 Abschussrampen gab. Ihre Reichweite betrug 2200 km. Die Armee nutzte dafür in diesem Zeitraum ein etwa 300 ha großes, mit Stacheldraht umzäuntes Gelände, weniger als einen Kilometer von der Landstraße P34 Sinole-Silakrogs entfernt. Die Wohnbereiche und der streng geheime Teilkomplex sind noch heute vorhanden. Betonstraßen führen zu den damals gut getarnten Hangars, Abschussrampen und Raketenbunkern. Auf mehreren Dutzend Hektar erstrecken sich verschiedene Bauten, die zur Wartung und Instandhaltung der Atomraketen dienten. Das Gelände verfügte über ein unabhängiges Strom-, Wasser- und Heizungsnetz, das beim Abzug der Armee unbrauchbar gemacht wurde. Ein Teil der Technik wurde damals der Gemeinde überlassen. Heute sind 20 ha des ehemaligen Raketenstützpunktes öffentlich zugänglich. Der südwestliche Teil wird als touristische Sehenswürdigkeit genutzt. Eine Besichtigung umfasst zwei Komponenten: die Dauerausstellung über die Entwicklung des Raketenstützpunktes im Museum Zeltiņi und eine Führung durch das Gelände des ehemaligen Stützpunkts. Auf dem Gelände gibt es die Möglichkeit für ein Laser-Game für bis zu 12 Mitspieler.
Wachturm der Grenzwache in Salacgrīva
Das Gebäude befindet sich in Salacgrīva, in nordöstlicher Richtung, 1 km von der Brücke über den Fluss Salaca entfernt.
Der sowjetische Militärstützpunkt in Salacgrīva war einer der ehemaligen Standorte der Besatzungstruppen. Dort befand sich eine relativ kleine Luftverteidigungseinheit, die 1992 als erste Militäreinheit Lettland verließ. In dieser Zeit kam es in Lettland zu groß angelegten Plünderungen, nachdem der lettische Staat den russischen Forderungen nachgegeben und den Abzug der Besatzungstruppen aus dem Gebiet gefordert hatte.
Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte die Sowjetarmee ihren rasanten und ambitionierten Ausbau militärischer Anlagen auf lettischem Gebiet fort. Die Militärbasen glichen einem Staat im Staate. Man geht davon aus, dass das besetzte Lettland zum am stärksten militarisierten Ort der Welt wurde und im Kriegsfall vollständig zerstört worden wäre. Kriminelle Verbrechen, imperialistisches Gebaren und Willkür prägten die Präsenz der Sowjetarmee in Lettland am deutlichsten. Der sorgsam gepflegte Mythos vom „glücklichen Leben im sowjetischen Lettland“ und der Sowjetarmee als „Befreier“ entpuppte sich in Wirklichkeit als „Leben auf einem Pulverfass“. Nach der Wiedererlangung der lettischen Unabhängigkeit verließ die ausländische Armee das Land erst 1994, doch Zehntausende pensionierte sowjetische Militärangehörige und ihre Familien blieben in Lettland.
Heute können Sie das Basisgelände besichtigen.
Ausstellung „Sowjetische Jahre“ im Museum für Geschichte und Kunst Aizkraukle
Zur Feier des hundertjährigen Bestehens Lettlands eröffnete das Museum für Geschichte und Kunst Aizkraukle im November 2018 die Ausstellung „Sowjetische Jahre“ – die größte Ausstellung im Baltikum, die dem kulturhistorischen Erbe der 1950er bis 1980er Jahre gewidmet ist. Die Ausstellung erstreckt sich über drei Etagen und eine Fläche von 1.060 m2. Sie zeigt das sowjetische Leben in seinen vielen Facetten: Alltag, Arbeit und Freizeit, Bildung und Kultur. Im Erdgeschoss sind Autos aus der Sowjetzeit ausgestellt. Separat ist eine Bibliothek – die Rote Ecke eingerichtet. Eine breit gefächerte Ausstellung lädt die Besucher ein, das Alltagsleben und die Innenausstattung der Wohnungen während der Sowjetzeit zu erkunden: Möbel und Haushaltsgegenstände, Geschirr, Textilien und Elektrogeräte.
Andere Ausstellungsräume sind der Emigration, der sowjetischen Repression, dem Alltagsleben, der Medizin, den staatlichen Strukturen, dem Tourismus und Sport, der Kindheit und Bildung gewidmet. Zu den verschiedenen Exponaten gehören auch sowjetische militärische Utensilien und Uniformen.
Ehemalige Raketenbasis der Sowjetarmee "Raketnieki"
Die Gebäude des ehemaligen sowjetischen Armeestützpunkts sind baufällig, aber auf dem Gelände gibt es eine Autostraße. Das Gebiet kann zu Fuß erkundet werden, aber gutes Schuhwerk gegen Schlamm und Sand ist erforderlich.
Sowjetischer Grenzschutzposten in Jūrmalciems
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Lettland verschiedene Verbote in Grenz- und Küstengebieten. Ab dem 19. Juni 1945 wurden den Fischern Anlegestellen zugewiesen, die mit Stacheldraht umzäunt waren und von Patrouillen und Wachtürmen bewacht wurden. Am 4. September 1946 wurden die Sperrzonen der Küstenwache an der Westgrenze der LSSR eingeführt.
Im Dorf Jūrmalci steht ein ehemaliger Grenzkontrollposten, ein Turm und ein Traktor, der stolz am Strand schaukelt! Wie er dorthin gekommen ist, muss man die örtlichen Führer fragen!
Ein fabelhaft schöner und interessanter Ort - sowohl mit seiner Aura aus der Sowjetzeit als auch mit dem Charme der Meeresküste.
Schießplatz Zvārde und ehemaliger sowjetischer Militärstützpunkt "Lapsas"
Der Stützpunkt der Deponie befindet sich etwa 2 km östlich des Gutes Striķu an der Straße Saldus-Auce. Der ehemalige sowjetische Militärflugplatz (Militäreinheit Nr. 15439) in Zvārde befindet sich südlich von Saldus. Auf dem Gelände des Flugplatzes befinden sich mehrere Sehenswürdigkeiten - die Ruinen der Kirchen von Zvārde und Ķerkliņi, der zerstörte Rīteļi-Friedhof, der Beobachtungsposten des Flugplatzes, der so genannte "Offizierskurgan" und der ehemalige Flugplatzpersonalstützpunkt und Schießplatz "Lapsas".
Der Flugplatz Zvārde erforderte eine Einheit von etwa einer Kompanie zur Wartung des Flugplatzes - zur Aufstellung von Zielscheiben, zur Reparatur von Schäden, zur Bewachung des Flugplatzes und zur Koordinierung von Flügen. Sie war bis zum Zweiten Weltkrieg auf dem Gelände des Hauses "Lapsas" stationiert. Mit dem Bau des Flugplatzes wurden auch Kasernen, Transporthallen, ein Flugkontrollturm und ein Schießplatz für das Ausbildungspersonal errichtet.
Nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Lettlands war hier das Ausbildungszentrum der Verteidigungsstreitkräfte von Zvārde untergebracht. Seit 2007 befindet sich das Gelände im Besitz der Gemeinde und wird von mehreren Jagdkollektiven gepachtet. In der ehemaligen Kaserne ist eine Ausstellung über die Geschichte der Gemeinde Zvārde untergebracht.
Leuchtturm Akmensrags und Schicksal von "Saratov"
Der Leuchtturm gehört zur Gemeinde Saka und liegt etwa 10 km südwestlich von Pāvilosta. Er ist über eine Wendeltreppe zu erreichen und bietet einen Rundblick auf das Meer und die umliegenden Wälder. Der heutige 37 m hohe Leuchtturm wurde 1921 errichtet, nachdem der Vorgängerbau im Ersten Weltkrieg zerstört wurde.
Der Leuchtturm von Akmenrags ragt in seiner Bedeutung über alle anderen Leuchttürme Lettlands hinaus – steht er doch an einer der gefährlichsten Stellen für die Schifffahrt an der gesamten Ostseeküste. Sein Leuchtfeuer markiert eine etwa zwei Seemeilen bzw. 3,7 km lange steinige Sandbank, die sich in nordwestlicher Richtung im Meer erstreckt. Die Wassertiefe beträgt hier nur etwas mehr als zwei Meter. Der Leuchtturm steht an seiner ursprünglichen Stelle, aber die Küstenlinie hat sich ihm bis heute immer mehr angenähert. Obwohl hier seit 1879 ein Leuchtfeuer die Schifffahrt warnt, hat Akmensrags schon mehrere Schiffsunglücke erlebt. Das meiste Aufsehen erregte im September 1923 das Aufsetzen des lettischen Dampfers „Saratow“ auf die Sandbank. 1919 während des lettischen Unabhängigkeitskrieges hatte die Provisorische Regierung Lettlands kurzzeitig Zuflucht auf eben diesem Dampfer gesucht. In Akmensrags lag früher eine Einheit der sowjetischen Grenztruppen. Gebäude aus jener Zeit sind noch heute vorhanden.
Militärstützpunkt der sowjetischen Armee in Pāvilosta - aktives Erholungszentrum
Während der Sowjetzeit war hier eine Grenzschutzeinheit stationiert, andere Einheiten der sowjetischen Armee - Verbindungsoffiziere und eine Boden-Luft-Raketenbasis - befanden sich einige Kilometer entfernt im Wald. Nach der Unabhängigkeit war dort die lettische Armee stationiert.
Der ehemalige Militärstützpunkt der Sowjetarmee ist heute ein Erholungs-, Freizeit- und Campingzentrum - für die persönliche Entwicklung im Umgang mit der Natur und den Menschen in der Umgebung.
Ein Ort der Erholung und Unterkunft sowohl für Touristengruppen als auch für Familien. Zimmer, Duschen, WC, Kamine, großzügiges Gelände für Aktivitäten, Naturgeräusche. Reservieren Sie im Voraus unter der Telefonnummer +371 26314505.
Frühere sowjetische Garnison in Mežgarciems
Eine Garnisonssiedlung der früheren sowjetischen Armee befindet sich in Mežgarciems im Landkreis Ādaži unweit der Landstraße P1. Auf dem einstigen Gelände der Luftabwehrtruppen der Sowjetarmee, das auch über einen Ausbildungsstützpunkt der Streitkräfte verfügte, sind heute Informationstafeln aufgestellt. Besucher können das Gelände des ehemaligen Armeestützpunktes erkunden. Auf Landkarten aus der sowjetischen Besatzungszeit sucht man Mežgarciems vergeblich. Nichts deutete auf ein für sowjetische Militärangehörige errichtetes Garnisonsstädtchen und den Luftabwehrstützpunkt hin. Nach dem Zweiten Weltkrieg setze eine rasche und umfangreiche Bautätigkeit zur Unterbringung der in Lettland stationierten sowjetischen Truppenteile ein. Die Militärstützpunkte dieser ausländischen Armee waren wie ein Staat im Staat. In fast allen Regionen Lettlands waren Truppenteile stationiert. Einen besonders privilegierten Teil der Gesellschaft bildeten pensionierte sowjetische Militärangehörige und deren Familien. Sie mussten bevorzugt mit Wohnraum versorgt werden. Viele ehemalige Offiziere wählten lettische Städte als Alterswohnsitz, weil hier der Lebensstandard höher war als andernorts in der Sowjetunion. Die Präsenz der sowjetischen Armee in Lettland und die gleichgültige Haltung des Regimes gegenüber Lettland und seiner einheimischen Bevölkerung manifestierte sich am deutlichsten in kriminellen Machenschaften, imperialem Gehabe und Rücksichtslosigkeit von Militärangehörigen. Der sorgfältig gepflegte Mythos vom „glücklichen Leben in Sowjetlettland“ und der „Sowjetarmee als Befreier“ war in Wirklichkeit wie ein „Leben auf dem Pulverfass“.
Adam Steel Schule
Das Schulgebäude befindet sich im Stadtzentrum auf der linken Seite der Ausekļa-Straße, neben dem Valka Jānis Cimze Gymnasium.
Das nach dem Lehrer Ādams Tērauds benannte Gebäude beherbergte ursprünglich eine Schule und wurde 1923 fertiggestellt. 1946 wurde hier das Hauptquartier der Armeegarnison eingerichtet. So entstand mitten in der Stadt Valka ein Militärzentrum, und Valka entwickelte sich zu einem wichtigen Standort für Atomwaffen der sowjetischen Armee. Das Gelände des Gebäudes war von einem hohen Zaun umgeben und wurde als Stadt in der Stadt bezeichnet, da es über einen eigenen Laden, ein Krankenhaus, ein Heizhaus und sogar ein Café für die Bedürfnisse der Armee verfügte. Das Symbol der Sowjetmacht – ein roter Stern – prangte auf dem Dach des Gebäudes. Die Armee verließ den Ort Ende der 1980er Jahre und nahm alles mit, was sie tragen konnte.
Unmittelbar daneben, hinter der Adam-Stahl-Schule und den unterirdischen Bunkern, befindet sich der schwedische (Scheremetjewo-)Wall. Dieser künstlich angelegte Erdwall wurde zu Beginn des Großen Nordischen Krieges um 1702 errichtet, um Valka vor den Schweden zu schützen. Die steilste Wallwand ist der Straße Ērģemi zugewandt, die andere Seite der Ausekļa-Straße.
Die Adam Steel Schule kann heute nur noch von außen besichtigt werden.
Bunkeranlage Valka
Die Bunker von Valka befinden sich im Zentrum von Valka, auf der linken Straßenseite der Ausekļa iela neben der Ādams-Tērauds-Schule. Sie sind nur von außen zu besichtigen. Die Bunker der Sowjetarmee in Valka gehörten zu den geheimsten Orten in Sowjetlettland, die nur mit Sondergenehmigung zugänglich waren. 1953-1989 befand sich hier ein Kommunikationsstützpunkt der Strategischen Raketentruppen der Sowjetarmee. Riesige Fahrzeuge auf 16 Rädern brachten große Stahlbetonblöcke zum Bau der Bunker. Nach Fertigstellung der Bunker selbst wurden diese zur Verstärkung und Isolierung mit Schotter bedeckt. In den Bunkern befand sich das Reservezentrum der strategischen Raketenkommunikation, das dem Leningrader Kommunikationszentrum unterstellt war. Von diesen Bunkern aus wurden die militärischen Raketenschächte gesteuert. In Valka und Umgebung gab es zwanzig. Im Oktober 1962, während der Kubakrise, wurden die Raketen mit Zielrichtung Florida in Gefechtsbereitschaft versetzt. Man sagt, dass nur eine Frage weniger Stunden war, dass die Raketen zum Einsatz gekommen wären. Gleich in der Nähe, hinter der Ādams-Tērauds-Schule und den Bunkern, liegt die einstige Schweden-Schanze (auch Scheremetew-Schanze). Der aufgeschüttete Erdwall wurde zu Beginn des Großen Nordischen Krieges um 1702 zur Verteidigung von Valka gegen die Schweden errichtet. In Richtung Ērģeme ist die Schanze am steilsten, während die andere Seite der Ausekļa iela zugewandt ist.
Bahnhof Valka
Der Bahnhof Valka liegt am Ende der Poruka iela, direkt an den stillgelegten Bahngleisen. Das Bahnhofsgebäude ist nur von außen zugänglich. Schautafeln informieren über die Bedeutung von Valka/Valga als Eisenbahnknotenpunkt. In der Nähe des Bahnhofes befindet sich ein Denkmal für die am 14. Juni 1941 nach Sibirien Deportierten. Das Bahnhofsgebäude wurde um 1896/97 errichtet. Ursprünglich lag es an der Schmalspurbahnstrecke Valka-Rūjiena-Pärnu. Während des Ersten Weltkrieges wurde die Bahnlinie schwer in Mitleidenschaft gezogen. Nach der Grenzziehung zwischen Estland und Lettland wurde der Bahnhof Valka (Valka II) zum Grenzbahnhof. Ende September 1920 traf eine Sonderkommission des Eisenbahnamtes in Valka ein, die den Auftrag hatte, mit Estland ein Abkommen über die Personenbeförderung von einem (vormals städtischen jetzt in zwei Staaten befindlichen) Bahnhof zum anderen auszuhandeln und abzuschließen. Das Gleisdreieck zwischen den Bahnstationen Lugaži, Valka und Valga war ebenfalls von strategischer Bedeutung, um Panzerzüge bei Bedarf in die entgegengesetzte Richtung wenden zu können. Während der Sowjetzeit benutzte die Sowjetarmee diese Bahnstation, um ballistische Raketen nach Valka zu bringen. In der Nacht vom 13. auf den 14. Juni 1941 fanden Massendeportationen von Menschen aus Lettland in das Innere der UdSSR statt. Mehr als 90 Personen aus Valka und Umgebung wurden ohne Gerichtsurteil, ohne vorherige Ankündigung und ohne Erklärung in Viehwaggons vom Bahnhof Valka aus deportiert. Im September 1944 wurde der Bahnhof beim Rückzug der Wehrmacht zerstört.
Sommerlager der lettischen Armee in Litene
Das Sommerlager der lettischen Armee in Litene befindet sich in einem Waldgebiet in der Gemeinde Litene, dicht am Fluss Pededze. Die Geschichte des Lagers Litene begann 1935, als die Division Latgale der lettischen Armee hier den Aufbau eine Sommerlager in Angriff nahm. Von Mai bis in den Herbst absolvierten in Litene tausende Soldaten Ausbildungs- und Schießtrainingsprogramme. Im Sommer 1941 wurden Offiziere der lettischen Armee von Einheiten der Roten Armee und des NKWD (Vorläufer des KGB) im Sommerlager Litene festgehalten und interniert. Ein Teil der Offiziere wurde in Litene erschossen, andere nach Sibirien deportiert. Am 14. Juni 1941 wurden in den Lagern Litene und Ostrovieši (etwa 10 km von Litene entfernt) mindestens 430 Offiziere verhaftet und nach Sibirien deportiert. Das einzige vom damaligen Lager noch erhaltene Gebäude ist das Lebensmittellager. Von den anderen Bauten sind nur noch Fundamente erkennbar. Eine Aussichtsplattform über der eine lettische Flagge weht, Bänke und eine Lagerfeuerstelle wurden hier inzwischen geschaffen. Mit Unterstützung des Verteidigungsministeriums und der nationalen Streitkräfte wurde ein nicht mehr einsatzfähiges Geschütz aufgestellt. Auch Informationstafeln wurden errichtet. Zum Andenken an die Vorgänge im Sommerlager wurde auf dem Friedhof von Litene eine „Mauer des Schmerzes“ errichtet. Auf YouTube ist im Kanal der lettischen Armee („Latvijas armija“) ein Kurzfilm unter dem lettischen Titel „Litene - Latvijas armijas Katiņa“ (Litene – Das Katyn der lettischen Armee) abrufbar.
Gulbene County Geschichts- und Kunstmuseum
In der Nähe des Herrenhauses Vecgulbene, in der Litenesstraße gelegen.
In der zweiten Hälfte der 1940er Jahre war die Radarkompanie Nr. 75568 der Sowjetarmee in der Orangerie des Gutshofs Vecgulbene und dem angrenzenden Gärtnerhaus stationiert. Für ihren Bedarf wurden Peilstationen errichtet und auf dem ehemaligen lettischen Militärflugplatz Peilstationen installiert. Ende der 1980er Jahre wurde die Einheit in die Gemeinde Beļava verlegt. Die Sowjetarmee verließ Gulbene 1993.
Ein Platz ist zu erkennen, mit zwei künstlich aufgeschütteten Hügeln in der Litenes Street.
Gedenkstätte „Mauer des Schmerzes“
Auf dem Friedhof von Litene befinden sich Kunstwerke.
Am 14. Juni 2001 wurde auf dem Friedhof von Litene die von den Architekten Dina Grūbe, Benita und Daiņš Bērziņš sowie den Steinmetzen Ivars Feldbergs und Sandras Skribnovskis geschaffene Gedenkstätte „Mauer des Schmerzes“ enthüllt. Sie symbolisiert die Ruhestätte der 1941 gefallenen Soldaten. Im Oktober 1988 wurden die sterblichen Überreste von elf Offizieren, die im Juni 1941 von der Sowjetarmee ermordet worden waren, auf dem Gelände des ehemaligen lettischen Armee-Sommerlagers in Sita sila (Gemeinde Litene) gefunden. Obwohl sie nicht identifiziert werden konnten, wurden sie am 2. Dezember 1989 nach einer Weihezeremonie in der evangelisch-lutherischen Kirche Gulbene feierlich auf dem Friedhof von Litene beigesetzt.
11 weiße Kreuze, eine Gedenktafel und Informationstafeln.
Erinnerungsstätte für die nationalen Partisanen von Sērmūkši mit Unterstand
In Sērmūkši befindet sich eine der mehr als einhundert Partisanen-Erinnerungsstätten in Lettland. Insgesamt fanden an mehr als sechshundert Orten in Lettland Partisanenkämpfe statt. Der nach historischen Vorbildern erbaute Unterstand lettischer nationaler Partisanen bietet nach vorheriger Anmeldung Übernachtungsmöglichkeiten - Holzpritschen, Petroleumlampen und Heizen wie zu Zeiten der Partisanen. Das Schicksal ereilte die Gruppe der nationalen Partisanen von Sērmūkši am 29. November 1946, als vier Kämpfer der Gruppe fielen - Jānis Zīrāks, Reinholds Pētersons, Jānis Pīlands, Anna Zariņa. Alfrēds Suipe entging diesem Schicksal. Er überlebte auch die Deportation, kehrte nach Lettland zurück und erlebte die Wiedergeburt des freien Lettland. Auf seine Initiative hin entstand diese Erinnerungsstätte für seine gefallenen Kameraden in Sērmūkši.
Denkmal für den Kommandanten der nordöstlichen nationalen Partisanen Pēteris Supe - "Cinītis"
Zum Gedenken an den Partisanenführer Pēteris Supe wurde am 28. Mai 2005 in Viļaka ein Denkmal enthüllt. Es befindet sich in der Nähe der katholischen Kirche von Viļaka, am Rande der während des Krieges ausgehobenen Schützengräben, in denen die Tschekisten die erschossenen Partisanen bestatteten. Unter dem Denkmal für P. Supe liegt eine Kapsel mit den Namen von 386 gefallenen Partisanen, Beschreibungen von Schlachten und Informationen über den Partisanenführer. In den Stein ist die Inschrift eingraviert: „Dir, Lettland, blieb ich bis zu meinem letzten Atemzug treu.“
Das Denkmal wurde von Pēteris Kravalis entworfen.
In der Nähe befindet sich ein Denkmal für die lettischen Freiheitskämpfer, die im Stompaku-Wald und an anderen Schlachtorten fielen und in den Jahren 1944-1956 von den Tschekisten ermordet wurden.
Am 20. Juni 2008 wurde an der rechten Wand eine Granittafel enthüllt, auf der die Namen von 55 gefallenen Partisanen in drei Spalten angeordnet waren.
Das Denkmal wurde an der Stelle errichtet, an der die kommunistischen Besatzungsbehörden einst die Überreste ermordeter Partisanen zur Schau gestellt hatten, um die übrige Bevölkerung einzuschüchtern.
Auf der angrenzenden Gedenktafel sind Dankesworte an Pēteris Supe und ein Gedicht von Bronislava Martuževa eingraviert:
"Steh auf, Peter Supe,
Seele, kämpfe im Krieg!
Heute ist euer Blutopfertag.
Auferstanden unter dem Volk.
Geh hinaus und lebe für immer!
In der Kraft und Tatkraft der Jugend,
Es flattert, flattert, flattert
"In der aufgehenden Flagge!"
„Waldbrüder“ - Bunker nationaler Partisanen
Der Bunker der sog. Waldbrüder liegt an der Fernstraße A 2 Riga-Pskow, 76 km von Riga und 11 km von Cēsis entfernt. Die lettischen nationalen Partisanen, auch Waldbrüder genannt, waren kleine bewaffnete Gruppen von Einheimischen, die von 1944 bis 1956 auf sich gestellt gegen das sowjetische Besatzungsregime in Lettland kämpften. Es waren Menschen, die nicht in der Sowjetunion leben konnten oder wollten und gezwungen waren, sich in den Wäldern zu verstecken. In ganz Lettland waren etwa 20.193 Waldbrüder aktiv. Der Bunker wurde nach Berichten und Erinnerungen ehemaliger Waldbrüder über das Leben in Wäldern und Verstecken und den Kampf für einen unabhängigen lettischen Staat nach 1945 errichtet. Im Bunker sind Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände, persönliche Gegenstände, Waffen und Fotos von Partisanen ausgestellt. Videoaufzeichnungen von Interviews mit ehemaligen Waldbrüdern ergänzen die Ausführungen des Ausstellungsführers. In der Nähe des Bunkers wurde ein Lagerfeuer-Picknickplatz angelegt. Zum Angebot gehören auf dem Lagerfeuer gekochte Suppe, Abende am Lagerfeuer und Freiluftkino (alles nach Vorbestellung).
Nationale und sowjetische Partisanenkämpfe und Gedenkstätten im Grīva-Wald
Im Waldmassiv von Grīva gelegen.
Sechs Objekte, die mit den Schauplätzen nationaler und sowjetischer Partisanenkämpfe in Verbindung stehen, können besichtigt werden.
Im Waldmassiv von Grīva befinden sich nicht nur das Hauptquartier der nationalen Partisanen „Purvsaliņi“, das Weiße Kreuz im nationalen Partisanenbunker und das Kreuz für den Kommandanten der Widerstandsbewegung, Andrejs Roskošs, sondern auch das Grab des Kommandanten der sowjetischen Partisanenbrigade, Artūrs Baložs, ein Denkmal auf dem sogenannten Meiteņu kalninė, wo 1944 eine Gruppe junger Partisanen der sowjetischen Partisanenbrigade umkam, sowie ein Denkmal für sowjetische Partisanen mit einem fünfzackigen Stern und den eingravierten Worten „Wir bedeckten uns mit unseren Nadeln“.
Die Objekte können auch auf einer Fahrradtour entlang des Radwegs Nr. 785 – „Historische Reime in den Grīva-Wäldern“ (34 km lange Strecke, Schotter- und Waldwege) – besichtigt werden. Karte zum Herunterladen.
Denkmal für den Kommandanten der nationalen Partisanengruppe Andrejs Roskošs (GPS 56.87399, 27.43524)
Im Herbst 1997 wurde im Wald von Lielgrīva ein Weißes Kreuz für den Kommandanten der nationalen Partisanengruppe, Andrejs Roskoš, enthüllt.
Denkmal für Artūrs Balodis (GPS 56.872926, 27.478121)
Artūrs Balodis war ein sowjetischer Partisan und Kommandeur der Spezialeinheit A, die im Waldmassiv Grīva stationiert war. Er fiel bei einer großangelegten Razzia der deutschen Besatzer. Seine Kameraden ritzten die Buchstaben AB in eine Birke an der Stelle seines Todes, damit er sie nicht vergaß. Nach dem Krieg entdeckten lokale Historiker die markierte Birke und brachten dort eine Gedenktafel an.
Allen, die in den Wäldern von Grīva (GPS 56.863280, 27.47975) gefallen sind
Dieser Gedenkstein im Waldmassiv von Grīva wurde vom Staatsunternehmen „Latvijas valsts meži“ zu Ehren der Partisanen errichtet, die für ihr Vaterland kämpften. Neben dem Gedenkstein befindet sich eine Karte mit den Standorten der Partisanenhauptquartiere – Sehenswürdigkeiten. Außerdem wurde ein Erholungsgebiet angelegt. In der Nähe liegt die Stätte der nationalen Partisanensiedlung aus den Jahren 1945–1947.
Nationales Partisanensiedlungsgebiet (GPS 56.863456, 27.481148)
Dieser Ort beherbergte die Siedlungen nationaler Partisanen, die gegen die sowjetische Besatzung kämpften. Die Standorte einzelner Bunker sind erhalten geblieben; anhand ihres Aussehens lässt sich die Größe und Form der Unterstände erahnen. Nationale Partisanen, die sich der sowjetischen Herrschaft widersetzten, operierten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mehrere Jahre lang in den Wäldern von Grīva.
Girls' Hill (GPS 56.858187, 27.521526)
Im Juni 1944 führten die nationalsozialistischen Besatzer eine großangelegte „Durchkämmung“ der Grīva-Wälder durch, um die Partisanen zu vernichten. Die Soldaten umstellten die landwirtschaftliche Arbeitsgruppe auf dem Numerne-Hügel, die hauptsächlich aus jungen Mädchen bestand, und alle wurden erschossen. Seit diesen tragischen Ereignissen haben die Einheimischen den Numerne-Hügel in Meiteņu Kalniņu umbenannt. An dieser Stelle wurde ein Gedenkstein errichtet.
Gedenkstein für die nationalen Partisanen der Gemeinde Alsviķi in "Čūskubirzī"
Liegt in „Čūskubirzs“, Gemeinde Alsviķi, Gemeinde Alūksne.
Der Gedenkstein wurde am 21. August 2018 enthüllt. Steinmetz Ainārs Zelčs.
Hier, im Waldmassiv, ist der Standort eines Bunkers erhalten geblieben, in dem sich im Juni 1947 Antons Circāns, Leiter der Kommunikationsabteilung des Generalstabs des Lettischen Nationalen Partisanenverbandes, mit Partisanenvertretern unter der Führung von Bruno Bukalders traf, um die Kommunikation zwischen den einzelnen nationalen Partisanengruppen zu organisieren und aufrechtzuerhalten. Antons Circāns' Ziel blieb unerfüllt, da er am 7. Juli 1947 in der Nähe von Drusti starb.
Gedenktafel für die nationalen Partisanen von Veclaicene am Standort des Bunkers
Liegt in der Gemeinde Veclaicene, Region Alūksne.
Eröffnet am 4. Oktober 2019. Steinmetz Ainārs Zelčs.
Am 13. März 1953 entdeckten die Tschekisten in den Wäldern von Veclaicene in der Nähe der Häuser von "Koruļi" einen sorgfältig getarnten Bunker und verhafteten Bernhards Ābelkoks und Elmārs Tortūz.
Im Bunker wurden Waffen gefunden: 2 deutsche Gewehre und 95 Patronen, 2 „Parabellum“-Pistolen und 152 Patronen.
Am 11. November 1949 erschossen Tscheka-Agenten K. Dokti-Dokteniekus, woraufhin sich seine Gruppe auflöste. Nach dem Anschlag versteckten sich B. Ābelkoks und E. Tortūzis einige Zeit in einem Bunker nahe der Häuser in „Maskaļi“. Ab Frühjahr 1951 errichteten sie mit Unterstützung von Ilona Ābolkalna einen Bunker in „Koruļi“, wo sie bis zu ihrer Verhaftung lebten.
Gedenkmuseum für Broņislava Martuževa - Poesiescheune
Das Broņislava-Martuževa-Museum befindet sich an der Stelle des Geburtshauses der Dichterin in der Gemeinde Indrāni im Landkreis Madona. Es ist in einer renovierten Scheune untergebracht, die Audio- und Videoaufzeichnungen als Zeitzeugnisse der Widerstandsbewegung birgt und über ein von ihr erstelltes Untergrundjournal mit Gedichten und Liedern für die nationalen Partisanen Zeugnis ablegt. Broņislava Martuževa war von Anfang an in der Widerstandsbewegung aktiv. Der nicht erhaltene Hof der Martuževs namens “Lazdiņas“ war auch Zufluchtsort für den Anführer des lettischen nationalen Partisanenverbandes, Pēteris Supe, und seine Kameraden. Hier versteckte sich die Dichterin fünf Jahre lang im Keller ihres eigenen Hauses, traf Partisanen, schrieb Gedichte (darunter Widmungen für die Partisanen Pēteris Supe, Vilis Tomas, die Smilga-Gruppe, Laivenieks, Salns, Celmiņš, Bruno Dundurs usw.), schrieb Lieder und brachte sie den Partisanen bei. Heute werden ihre Lieder von der Gruppe „Baltie lāči“ gesungen. 1950 gab sie im Untergrund zusammen mit Vilis Toms die Zeitschrift „Dzimtene“ heraus. Die Dichterin hat die 11 Ausgaben mit jeweils 10 Exemplaren per Hand abgeschrieben. 1951 wurden die Dichterin, ihr Bruder, ihre Schwester, ihre Mutter und Vilis Toms verhaftet. 1956 kehrte Broņislava Martuževa aus Sibirien zurück. Die Poesiescheune ist sowohl in der Region als darüber hinaus bekannt und wird sowohl von Einheimischen als auch von Auswärtigen gerne besucht. Der Lebenslauf der Dichterin spiegelt das Schicksal Lettlands exemplarisch wider.
Denkmal für die gefallenen Soldaten der Lettischen Legion und die nationalen Partisanen
Befindet sich auf dem Lubāna New Cemetery in der Gemeinde Indrāni.
Eine Gedenkstätte für die gefallenen Soldaten der Lettischen Legion und die nationalen Partisanen kann besichtigt werden.
Das Denkmal wurde am 25. Juli 1992 eingeweiht. Der Gedenkstein wurde von Andris Briezis geschaffen.
Mit Beginn der Erweckungsbewegung im Oktober 1990 erhielt Kārlis Doropolskis, ein Mitglied der Menschenrechtsgruppe „Helsinki 86“, die Genehmigung der Behörden, die Umbettung der im Sommer 1944 in Lubāna gefallenen und verstreut begrabenen lettischen Legionäre sowie der in späteren Kämpfen gegen die sowjetischen Besatzungstruppen und Sicherheitskräfte gefallenen Partisanen in Massengräbern auf dem neuen Friedhof in Lubāna zu beginnen. Insgesamt wurden 26 gefallene Legionäre und Partisanen in Massengräbern beigesetzt.
Gedenkstätte des Bunkers der nationalen Partisanengruppe „Jumba“
Gelegen in der Gemeinde Ziemers, im 66. Block des Staatswaldes.
Das Denkmal wurde am 10. Juli 2020 eröffnet.
In der zweiten Phase der lettischen Partisanenbewegung, Mitte 1948, spaltete sich eine Gruppe von vier Personen – Viks Pētersi, Stebers Rolands, Bukāns Ilgmārs und Kangsepa Elvīra – im Gebiet der Pfarreien Mālupē-Beja von der Einheit J. Bitāns-Liepačs ab und begann in den Pfarreien Ziemera-Jaunlaicene-Veclaicene eigenständige Aktivitäten. Das Partisanenhauptquartier befand sich nahe der estnischen Grenze, unweit der Autobahn Riga-Pskow, auf einem Hügel in einem gut ausgebauten Bunker.
Am 2. März 1950, als die Tschekisten den Bunker entdeckten, versteckten sich die Partisanen in einer aus Steinen errichteten Scheune im Haus „Napke“ auf estnischer Seite. Nach einem langen und heftigen Feuergefecht gelang es den Tschekisten am 3. März 1950, die Scheune in Brand zu setzen. Ilgmārs Bukāns, Rolands Stebers und Elvīra Kangsepa verbrannten zusammen mit ihrer neugeborenen Tochter. Pēteris Viks sprang aus dem Fenster der Scheune und versteckte sich auf dem Dachboden des Hauses, wo er gefunden und erschossen wurde. Der Bauernhof brannte nieder. Die Leichen aller gefallenen Partisanen wurden nach Alūksne gebracht. Anfang der 1990er Jahre wurde an der Stelle, wo die Kämpfer starben, eine Gedenktafel errichtet. Elvīra Kangsepas Tochter, die in der brennenden Scheune geboren wurde, erhielt den Namen Liesma.
Das Hauptquartier der nationalen Partisanen im Naturschutzgebiet „Stompaku-Sümpfe“
Während des Zweiten Weltkriegs war der Stompaku-Sumpf eines der größten nationalen Partisanenlager im Baltikum. Heute ist das Gebiet Teil des Naturschutzgebiets Stompaku-Sümpfe. Die Siedlung auf den Sumpfinseln ist über einen markierten Steg zu erreichen.
Anfang 1945 lebten 350–360 Personen, darunter 40–50 Frauen, im Lager der nationalen Partisanen im Stompaku-Sumpf. Das Lager bestand aus 24 halb in den Boden eingebauten Wohnbunkern, die Platz für 3–8 Personen boten. Es gab eine Bäckerei, einen Kirchenbunker und drei oberirdische Anlagen für Pferde. Partisanen aus dem Lager verübten Anschläge auf führende Kräfte des Besatzungsregimes.
Am 2. und 3. März 1945 fand hier die Schlacht von Stompaki statt – die größte in der Geschichte der lettischen Nationalpartisanen. Die 350–360 Partisanen im Lager wurden vom 143. Gewehrregiment des NKWD und lokalen Kämpfern des Istrebikel-Bataillons (insgesamt 483 Mann) angegriffen. Die Schlacht dauerte den ganzen 2. März. In der Nacht zum 3. März gelang es den Partisanen, aus dem Lager auszubrechen und sich in ihren vorherigen Stützpunkt zurückzuziehen. Die Schlacht forderte 28 Partisanen, während der NKWD 32 Kämpfer verlor. Heute befinden sich auf dem Gelände des Lagers Stompaki drei restaurierte Bunker – eine Kirche, ein Hauptquartier und ein Wohnbunker sowie 21 ehemalige Bunkerstandorte. Es wurden Informationstafeln über das Lager und die Schlacht aufgestellt. Es können Führungen gebucht werden
Erdhütte der Partisanen von Veseta und Gedenkstätte „Weißes Kreuz“
Die Erdhütte der Partisanen von Veseta und die Gedenkstätte „Weißes Kreuz“ befinden sich im Sumpfgebiet von Veseta.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war die so genannte Pārups-Gruppe in Vietalva aktiv. Ihr Leiter Rihards Pārups (1914–1946) war während des Zweiten Weltkriegs Feldwebel in der 15. lettischen Division der deutschen Wehrmacht. Er nahm an nationalen Partisanenoperationen in der Umgebung von Jēkabpils und Madona teil. Während ihres kurzen Bestehens war die Pārups-Gruppe an mehr als 20 bewaffneten Zusammenstößen mit Einheiten des damaligen Innenministeriums beteiligt.
Im Bericht von Tscheka-Oberst Kotov an den Stabschef in Riga heißt es, dass die sowjetischen Behörden in den Bezirken Jēkabpils und Madona durch die Aktivitäten der Gruppe lahmgelegt wurden. Nationale Partisanen unter der Führung von Pārups fanden und vernichteten mehrere Deportationslisten und retteten somit viele Menschenleben. Da die Führung des Sicherheitskomitees nicht in der Lage war, die nationale Partisaneneinheit im offenen Kampf zu vernichten, schleuste sie vier Mitglieder der Tscheka-Spezialgruppe in die Gruppe ein. In der Nacht zum 2. Juli 1946 erschossen diese Agenten zehn Partisanen der Einheit, darunter Rihards Pārups.
Der Ort, an dem die Gefallenen begraben wurden, ist nicht bekannt, aber auf dem Brüderfriedhof Riga wurde eine Gedenktafel zu ihrem Andenken errichtet. An der Erdhütte der Partisanen von Veseta befindet sich die Gedenkstätte „Weißes Kreuz“, ein 3 Meter hohes weißes Kreuz mit einer Tafel, auf der die Namen der am 2. Juli 1946 gefallenen Partisanen stehen.
Denkmal für die Teilnehmer der Widerstandsbewegung in Stompaki
Das Hotel liegt 15 km von Balvi entfernt in Richtung Viļaka, auf der rechten Straßenseite.
Ein Gedenkschild ist sichtbar.
Am 11. August 2011, dem Gedenktag der lettischen Freiheitskämpfer, wurde an der Straße Balvu-Viļakas gegenüber dem Stompaku-Sumpf ein Denkmal für die Teilnehmer der Widerstandsbewegung enthüllt. Es ist den nationalen Partisanen von Pēteris Supe gewidmet, die in den Kämpfen vom 2. und 3. März 1945 gefallen sind. Ende Juli wurde eine Zeitkapsel mit einer Botschaft für zukünftige Generationen in das Fundament des Denkmals eingelassen. In der Kapsel befindet sich ein Dokument mit den Namen von 28 nationalen Partisanen, die in den Kämpfen vom 2. und 3. März 1945 gefallen sind.
Im Februar 1945 wurde auf den Inseln des Stompaku-Sumpfes, die die Bevölkerung bald als Stompaku-Sumpfinseln bezeichnete, zwei Kilometer von der Straße Balvi-Viļaka entfernt, das größte Partisanenlager Lettlands errichtet. Dort lebten 360 Menschen in 22 Unterständen. Unter ihnen befanden sich auch Legionäre, die nach dem Rückzug ihrer Division mit all ihren Waffen im Haus ihres Vaters geblieben waren. Um die Partisanen zu vernichten, griffen Soldaten zweier Tscheka-Bataillone am 2. März 1945 die Unterstände zusammen mit Panzerabwehrkanonen an, die auch über vier Mörser verfügten. Die Kämpfe dauerten den ganzen Tag. Die Partisanen leisteten hartnäckigen Widerstand, und die Angreifer erlitten schwere Verluste, sodass sie das Lager nicht einnehmen und die Partisanen nicht vernichten konnten. 28 Bewohner des Stompaku-Sumpfes fielen in der Schlacht oder starben an ihren schweren Verletzungen. In der folgenden Nacht gelang es den Partisanen schließlich, das Lager zu durchbrechen. „Belagerung und unbesiegt zurückgelassen“ – so schreibt Zigfrīds Berķis, Vorsitzender der Kommission für die Angelegenheiten der Teilnehmer der Nationalen Widerstandsbewegung in der Auszeichnungsabteilung, über die Schlacht von Stompak.
Private Ausstellung „Räume von Abrene“
Die Ausstellung „Räume von Abrene“ befindet sich in der Stadt Viļaka, in einem Gebäude mit einer wechselvollen Geschichte. Anfangs befand sich das Gebäude auf dem alten Marienhausen-Marktplatz, später beherbergte es Wohnungen, Büros und verschiedene Geschäfte, und während des Zweiten Weltkriegs war es das Hauptquartier der lettischen Selbstverteidigung, der Gestapo und der Tscheka. Mehrere Ausstellungen zeigen verschiedene Ereignisse und historische Abschnitte in der Stadt Viļaka und ihrer unmittelbaren Umgebung zwischen 1920 und 1960, als Viļaka Teil des Kreises Abrene von Neu-Lettgallen war. Sie zeigen Gegenstände aus dem Partisanenhauptquartier im Stompaku-Sumpf, die mit der nationalen Partisanenbewegung in Lettgallen in Verbindung standen. Außerdem gibt es Dokumente und Fotos aus dem Unabhängigkeitskrieg. Die neueste Ausstellung ist der einst berühmten Motocross-Strecke „Baltais briedis“ gewidmet.
Gedenkstätte „Bitāna Bunkers“
Liegt in der Gemeinde Mālupe, Gemeinde Alūksne.
Der Gedenkstein wurde am 13. Oktober 2017 enthüllt. Steinmetz Ainārs Zelčs.
Am 24. August 1945 wurde in Latgale, in den Wäldern von Dubna, der Lettische Nationale Partisanenverband (LNPA) mit dem Ziel der Wiederherstellung der Republik Lettland von 1918 gegründet. Zur besseren Koordinierung der Aktivitäten der Partisanengruppen wurden regionale Hauptquartiere eingerichtet. Die in den Gemeinden Beja, Mālupė und Mārkalne operierenden nationalen Partisanengruppen vereinigten sich im Sektor „Priedolaine“. Das regionale Hauptquartier wurde von Jānis Liepacis geleitet. In jedem regionalen Hauptquartier wurden Propagandaabteilungen eingerichtet. Eine dieser Abteilungen, unter dem Kommando von Jānis Bitāns, befand sich im Waldgebiet der Gemeinde Mālupė. Hier im Bunker wurden von 1946 bis 1948 fünf Publikationen des Lettischen Nationalen Partisanenverbandes gedruckt: „Mazais Latvis“, „Liesma“, „Auseklis“, „Māras Zeme“ und „Tautas Sargs“. Die Jugendwiderstandsbewegung „Dzimtenes Sili“ des Alūksne-Gymnasiums war an der Aufbereitung und Verbreitung der Informationen beteiligt.
Gedenkstein in Ilzene in der Nähe der Häuser „Sarvi“ und „Meļļi“.
Gelegen in der Gemeinde Ilzene, Stadt Alūksne.
Der Gedenkstein wurde am 28. September 2018 enthüllt. Steinmetz Ainārs Zelčs.
Die Bewohner dieser Häuser in der Gemeinde Ilzene unterstützten ab Herbst 1944 die von Voldemars Anderson („Vecs“) angeführten nationalen Partisanen, deren Bunker sich in der Nähe im dichten Wald befand. Am 23. November 1945 wurde der Bunker von NKWD-Soldaten umstellt. Neun Kämpfer starben in dem Gefecht. Anschließend wurden zwei Maschinengewehre, 14 automatische Gewehre, elf Gewehre, zehn Pistolen, 3.500 Patronen, 45 Handgranaten und vier Ferngläser sichergestellt. Die Zerschlagung von Voldemars Andersons Gruppe war in der Tscheka-Operation „Kette“ („Цепь“) dokumentiert.
Die Gruppe bestand aus Voldemārs Pāvels Andersons („Vecais“), Gastons Dzelzkalējs, Voldemārs Tonnis, Centis Eizāns, Osvalds Kalējs, Jānis Koemets, Stāvais („Polis“), Voldemārs Rappa, Eduards Rappa und Elmārs Rappa (blieben am Leben).
Gedenkmuseum-Deportationswaggon am Bahnhof Skrunda
Zur Erinnerung an die sowjetischen Deportationen vom Juni 1941 und März 1949 wurden am Bahnhof Skrunda ein Gedenkstein und ein vierachsiger Eisenbahnwaggon als Gedenkmuseum für die Verschleppten errichtet. Es handelt sich hier um den ersten Waggon in Lettland, in dem eine ständige Ausstellung eingerichtet wurde. Sie umfasst Fotos, Briefe, Zeitzeugenberichte und Dokumente der vom Bahnhof Skrunda aus Deportierten sowie verschiedene von ihnen selbst hergestellte Gebrauchsgegenstände. Der Bahnhof Skrunda war eine Sammelstelle für die zur Deportation bestimmten Menschen, eine der drei Bahnstationen des Kreises, zu der Einwohner sowohl aus Skrunda als auch aus der Umgebung von Kuldīga gebracht wurden. 1941 wurde auch die Familie von Guntis Ulmanis, dem ersten Präsidenten der wiederhergestellten Republik Lettland, von hier aus nach Sibirien in die Region Krasnojarsk verbracht.
Fahrten mit dem Boot „Zezer“ auf dem Ciecere-See
Bei einer Ausfahrt mit dem Freizeitboot „Zezer“ auf dem Ciecere-See bei Brocēni können Sie dem Audioguide und den Erzählungen des Kapitäns über den Ciecere-See und die Stadt Brocēni lauschen. Dabei geht es vor allem um die Ereignisse im Zweiten Weltkrieg rund um den Ciecere-See, die Schützengräben an beiden Seeufern und auf der Eicheninsel sowie die Panzerstraße in der Nähe des heutigen Aussichtsturmes und den im See versunkenen Panzer. Der Audioguide ist in vier Sprachen verfügbar - Lettisch, Litauisch, Englisch und Russisch. Die Rundfahrt dauert etwa 75 Minuten.
Private Sammlung von militärischen Gegenständen und Nähmaschinen
Die einzige Nähmaschinensammlung in Lettland mit mehr als 200 verschiedenen Nähmaschinen aus der Vorkriegs- und Sowjetzeit, die in den Vorkriegs- und Kriegsjahren eine direkte Rolle bei der Herstellung von Militärkleidung spielten. Ersteller der Sammlung - Juris Beloivans
Sowjetischer Soldatenfriedhof "Tuški"
Der brüderliche Friedhof der Soldaten des 130. lettischen und des 8. estnischen Schützenkorps der Roten Armee befindet sich etwa 350 m südwestlich der Straße Blīdene-Remte. Der Name leitet sich vom Bauernhof Tušķi ab, der sich 400 m südlich des Friedhofs befand.
Am 17. März 1945 begann der letzte Versuch der Roten Armee in Kurzeme. Die 308. lettische Schützendivision griff südwestlich und westlich des Gehöfts Tušķi an und überquerte in dreitägigen Kämpfen die Straße Blīdene-Remte im Gebiet 142.2 der Hochebene und erreichte die Linie Jaunāsmuižas-Mezmali. Die bei den Kämpfen gefallenen Soldaten wurden auf mehreren kleinen Friedhöfen in der Nähe von Ķēķiai, Vērotāji, Jaunāsmuiža und anderswo beigesetzt.
In den späten 1960er Jahren, als die Sowjetunion begann, des Zweiten Weltkriegs zu gedenken, wurde nördlich der Ruinen des Tušķu-Gehöfts ein neuer Friedhof angelegt, auf dem alle in der Gegend von Pilsblidene und Kaulači gefallenen Soldaten umbegraben werden sollten. In Wirklichkeit erfolgte die Umbettung nur teilweise, da die gefallenen Soldaten oft in ihren ursprünglichen Grabstätten verblieben, aber nur ihre Namen auf dem Friedhof der Brüder Tuški überschrieben wurden. Die Namen der Soldaten des 8. Estnischen Schützenkorps, dessen Hauptkriegsfriedhof sich an der Stelle des heutigen Friedhofs von Pilsblidene befand, sind ebenfalls auf dem Friedhof der Tuški-Brüder zu finden.
Dort befindet sich auch ein Denkmal für Jakob Kundera, einen Soldaten des 8. estnischen Schützenkorps, dem das Objekt "Kundera-Punkte" gewidmet ist. Unmittelbar nach der Schlacht wurde Jakob Kundera auf dem heutigen Friedhof von Pilsblidene begraben und später auf den Brüderfriedhof von Tuški umgebettet.
Ausstellung „Kämpfe um die Freiheit im 20. Jahrhundert“ im Geschichtsmuseum Jēkabpils
Im Schloss Krustpils gelegen
Ausstellung „Kämpfe um die Freiheit im 20. Jahrhundert“ zu sehen
Sowjetische Repressionen. Schmerzhafte Erinnerungen. Hier in einem Clubsessel sitzend, haben Sie die Gelegenheit, Auszüge aus dem Buch „Es gab solche Zeiten“ von Ilmārs Knaģis, einem Einwohner von Jēkabpils, zu hören. An einer der Wände des Raumes gleitet teilnahmslos eine Liste der nach Sibirien deportierten Bürger entlang, wie der Abspann eines Films. Gleich daneben, auf einem alten Fernseher, können Sie ein Amateurvideo über die Entfernung des Lenin-Denkmals in Jēkabpils ansehen. Die Besucher interessieren sich nicht nur für den Inhalt, sondern auch für die technischen Möglichkeiten – wie dieser Film auf einem alten Fernseher gedreht werden konnte.
Im Geschichtsmuseum Jēkabpils können Sie Vorträge von Museumsspezialisten anhören oder sich für eine Exkursion anmelden: Jēkabpils und seine Umgebung während des Ersten Weltkriegs, Jēkabpils im Jahr 1990, Die Zeit der Barrikaden, Deportationen von 1949 - 70, Jēkabpiler - Ritter des Lāčplēsis-Kriegsordens usw.
Die Vorlesungen dauern im Durchschnitt 40 Minuten. Informationen und Anmeldemöglichkeiten erhalten Sie unter den Telefonnummern 65221042 und 27008136.
Das Jēkabpils-Museum befindet sich in Schloss Krustpils. Nach dem Beitritt Lettlands zur UdSSR im Jahr 1940 war die 126. Schützendivision in Schloss Krustpils stationiert. Während des Zweiten Weltkriegs beherbergte das Schloss ein deutsches Lazarett und ab August 1944 ein Feldlazarett der Roten Armee. Nach dem Krieg dienten Schloss Krustpils und die angrenzenden Gutsgebäude als Zentrallager des 16. Fernaufklärungsfliegerregiments und der 15. Luftarmee der Sowjetarmee.
Flugplatz Vaiņode
Auf dem Flugplatz Vaiņode sind noch 16 in der Sowjetzeit errichtete Flugzeughangars sowie 1800 m der vormals 2500 m langen Start- und Landebahn erhalten. Der Flugplatz kann nur nach vorheriger Vereinbarung besichtigt werden. Der Flugplatz Vaiņode bildete in der Zeit des lettischen Freistaates die Wiege der lettischen Luftfahrt und später einen der größten Militärflugplätze im Baltikum. 1916 errichteten deutschen Truppen hier zwei Hangars für Luftschiffe. Diese Zeppeline dienten zur Aufklärung und Beschießung von Stellungen der russischen Armee. Später kaufte die Stadt Riga die Luftschiffhallen und nutzte ihre Dachkonstruktionen zum Bau der Pavillons des Rigaer Zentralmarktes. Im Mai 1940 wurde das 31. Geschwader der Luftstreitkräfte der Roten Armee mit Jagdbombern in Vaiņode stationiert. Damals wurde mit dem Bau einer einheitlichen Start- und Landebahn aus Betonplatten begonnen. Der noch unfertige Flugplatz diente zum Ende des Sommers 1944 verschiedenen deutschen Luftwaffenverbänden und ganz am Ende des Zweiten Weltkrieges den Luftstreitkräften der Roten Armee im Kampf gegen die deutsche Heeresgruppe Kurland. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren Einheiten der sowjetischen Luftstreitkräfte bis 1992 in Vaiņode stationiert.
Gutshof Pilsblidene
Das Herrenhaus wurde in den 1920er Jahren des 19. Jahrhunderts im klassizistischen Stil erbaut. Nach der Bodenreform wurde der Gutskomplex an Privatpersonen vermietet, aber ab 1932 ging er an das Ministerium für Volkswohlfahrt über.
6. Während der heftigen Kämpfe der großen Schlacht um Kurland wurde es sowohl als Stützpunkt als auch als Lazarett genutzt.
Am 17. März 1945 begann der letzte Versuch der Roten Armee, Kurland anzugreifen. Einheiten der deutschen 24. Infanteriedivision verteidigten sich in der Nähe des Gutskomplexes Pilsblidene. Am 18. März 1945 wurde das Herrenhaus von Süden her durch das 121. Schützenregiment der lettischen Schützendivision der 43. Das 1. Bataillon des 300. Schützenregiments der 7. estnischen Schützendivision griff von Westen her an, und am Ende des Tages schloss sich die 35. Panzerbrigade des 3. mechanisierten Gardekorps dem 1. Bataillon des 917. Schützenregiments der 249. estnischen Schützendivision auf der Straße Blīdene-Remte an.
In der Nacht zum 19. März traf das 43. Grenadierregiment der 19. lettischen SS-Grenadierdivision in der Nähe des Bahnhofs Blīdene ein und unternahm einen Gegenangriff, um das Wohnhaus des Herrenhauses von Pilsblīdene zurückzuerobern. Infolge eines nächtlichen Panzerangriffs gelang es estnischen und lettischen Einheiten der Roten Armee jedoch, sich am Bahnhof festzusetzen.
Im Jahr 1959 brach im Schloss ein Brand aus. Von 1961 bis 1986 befand sich in dem Wohngebäude ein Altersheim. Im Jahr 1986 wurde das Schloss erneut durch einen Brand zerstört. Seitdem steht das Schloss leer und ist eine Ruine.
Um das Schloss herum befindet sich ein 24 Hektar großer Park, der heute zugewachsen ist. Der Park besteht aus etwa 37 Anpflanzungen nicht einheimischer Baum- und Straucharten und steht unter staatlichem Schutz. Der Park ist ungepflegt, und die Umgebung ist überwuchert.
Gedenkstätte Bruderfriedhof-Soldatenfriedhof Priekule
Das Ensemble des Bruderfriedhofes Priekule an der Straße Liepāja-Priekule-Skuoda ist der größte sowjetische Soldatenfriedhof des Zweiten Weltkrieges im Baltikum. Hier wurden mehr als 23 000 sowjetische Gefallene beigesetzt. Die „Operation Priekule“ ab Oktober 1944 bis zum 21. Februar 1945 war eine der erbittertesten Kampfhandlungen in Kurland. Die für beide Seiten verlustreiche Schlacht von Priekule im Februar 1945 dauerte sieben Tage und Nächte ohne Unterbrechung. Bis zur Umwandlung der Kriegsgräberstätte in eine Gedenkstätte zierte den Bruderfriedhof Priekule das letzte vom herausragenden lettischen Bildhauers K. Zāle (1888-1942) geschaffene Denkmal, das ursprünglich zur Erinnerung an die Unabhängigkeitskämpfe in Aloja errichtet werden sollte. Zwischen 1974 und 1984 wurde der Bruderfriedhof Priekule auf einer Fläche von 8 ha zu einem Gedenkensemble für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs umgestaltet. Beteiligt waren die Bildhauerin P. Zaļkalne, die Architekten A. Zoldners und E. Salguss sowie der Dendrologe A. Lasis. Die 12 m hohe Skulptur der „Mutter Heimat“ steht im Zentrum der Gedenkstätte. Die Namen der Gefallenen sind in Granitplatten eingraviert. Bis zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit Lettlands 1991 wurde der Tag des Sieges alljährlich am 9. Mai hier groß gefeiert.
Scheune des Herrenhauses Nygrande
Das Heimatmuseum von Nīgrande befindet sich im Dorf Nīgrande in der Scheune des Herrenhauses neben der Grundschule von Nīgrande und ist nach Vereinbarung zugänglich.
Die militärgeschichtliche Abteilung des Archivs umfasst eine Ausstellung über den Zweiten Weltkrieg sowie Originalgegenstände und -teile, die nach dem Krieg und in späteren Jahren in der Gegend gefunden wurden. Sie können auch Geschichten und Fotos über Nygrande und seine Umgebung aus dem Unabhängigkeitskrieg, dem Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegszeit sowie über das Leben in der Kolchose in der Sowjetzeit erfahren.
Ein besonderer Platz in der Ausstellung ist dem lokalen Schriftsteller Jēkab Janševskis und seinen Werken gewidmet, und es gibt eine Ausstellung, die das traditionelle Leben und die Einrichtung des Herrenhauses zeigt. Ein in Nīgrande gefundener Mammut-Stoßzahn ist in der Scheune des Gutshofs Nīgrande ausgestellt.
Nationaler Partisanenbunker in Īle
Der Bunker befindet sich in der Gemeinde Zebrene, im Waldgebiet Īle, an der Abzweigung der Straße P104 Biksti-Auce.
Die Kārlis Krauja-Gruppe der nationalen Partisanen von Īle wurde 1947 gegründet. Zum Gruppenführer wurde V.Ž. Brizga (Spitzname K. Krauja) ernannt. Im Oktober 1948 schloss sich die Krauja-Gruppe mit der litauischen Nationalen Partisanengruppe zusammen. Die Krauja-Gruppe agierte im Kreis Jelgava und bestand aus 27 nationalen Partisanen.
Im Oktober 1948 baute die Krauja-Gruppe in der Gemeinde Lielauce, Kreis Jelgava, in der Nähe der Forstwirtschaft Īle, 300 Meter nördlich des Hauses „Priedaiši“, einen unterirdischen Bunker. Seine Gesamtlänge mit den Kampfgängen betrug 45 Meter. Um den Bunker herum wurden 70 ferngesteuerte Minen gelegt. Der Bunker war mit einem Ofen, einem Brunnen, einer Toilette und einem Lagerraum ausgestattet.
Am 17. März 1949 kämpften die 24 Partisanen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Bunker befanden, ihre letzte Schlacht gegen die 760 Mann starke Tscheka-Truppe. Nach der Schlacht wurden 9 Mitglieder der Gruppe verhaftet, 15 fielen jedoch in der Schlacht, darunter acht Letten und sieben Litauer.
Im Jahr 1992 grub die Landeswehr zusammen mit den Daugavas Vanagi (lettisch „Düna-Falken“) den gesprengten Bunker aus. An der Stelle wurden ein Weißes Kreuz, ein Gedenkstein und eine Granitstele errichtet.
Im Inneren des Bunkers sind ein Ofen, ein Tisch und schmale Bänke zu sehen, auf denen die Partisanen schliefen. Am Bunker befinden sich Informationstafeln und Gedenksteine mit den Namen der Partisanen.
Ausstellung über die Radaranlage Skrunda im örtlichen Herrenhaus
Im Herrenhaus von Skrunda wurde eine Ausstellung über die Radarstation bzw. die Funkortungsstation Skrunda und die Aktivitäten der Lettischen Volksfront eingerichtet. Die Funkortungsstation Skrunda, die unter dem Decknamen „Kombinat“ lief, gehörte zum Raketenfrühwarnsystem im westlichen Teil der UdSSR. 5 km von Skrunda entfernt in Richtung Kuldīga lag „Skrunda-2“, ein sowjetisches Militärstädtchen (в/ч 18951). Dort lag die Radaranlage „Dnepr“; eine neue modernere Anlage, „Darjal“, befand sich im Bau. Dieser wurde aber bald eingestellt und „Darjal“ am 4. Mai 1995 gesprengt. Auf der Grundlage zwischenstaatlicher Abkommen wurde die „Dnjepr“-Radaranlage am 31. August 1998 abgeschaltet.
Leuchtturm Mērsrags und Stützpunkt des Küstengrenzschutzes
Der Leuchtturm von Mērsrags befindet sich in Mērsrags, etwa 1 km nördlich des Ortskerns. Er wurde 1875 in Betrieb genommen. Die Höhe des Leuchtfeuers beträgt 21,3 m. Es handelt sich um eine 18,5 m hohe freistehende, zylindrische, genietete Metallkonstruktion, deren Unterteil mit Stahlbetonpfeilern verstärkt ist. Am oberen Teil befindet sich ein metallener auf Träger gestützter rundum begehbarer Balkon. Der Turm wurde in der Fabrik von Sotera, Lemonnier & Co in Paris gebaut, weshalb er auch „die Französin“ genannt wird. Ende 1944 war eine Batterie der 1003. Heeres-Küstenartillerie-Abteilung der Wehrmacht mit 60-cm-Scheinwerfern am Leuchtturm stationiert. Im Mai 1945 plante die nationalsozialistische deutsche Führung, die lettische 15. Waffen-Grenadier-Division der SS in das Gebiet zu verlegen, doch die lettischen Soldaten hatten sich bereits den Westalliierten ergeben. Am Leuchtturm von Mērsrags sind die Überreste eines Bauwerks erhalten, das während der Sowjetzeit einen großen, schwenkbaren Scheinwerfer trug, mit dem der sowjetische Grenzschutz auf das Meer hinausleuchten konnte. Am Leuchtturm gibt es einen Turm zur Vogelbeobachtung. Besuche sind nach vorheriger Anmeldung möglich, anzufragen bei der Touristeninformation Mērsrags.
Grenzwachturm in Mazirbe
Zur ehemaligen Marineschule Mazirbe gehörte ein Stützpunkt des sowjetischen Grenzschutzes mit einem bis heute gut erhaltenen Wachturm. Ein weiterer Beobachtungsturm befindet sich direkt am Strand in der Nähe des Parkplatzes. Die Türme sind Relikte aus der Zeit der sowjetischen Besatzung, als Mazirbe zum grenznahen Sperrgebiet gehörte. Zivilisten durften damals nur bestimmte Strandabschnitte betreten und dies auch nur tagsüber. Der ehemalige Wachturm des Grenzschutzes ist einer der besterhaltenen in Lettland. Betreten auf eigene Gefahr!
Nautische Schule Mazirbe
Der sowjetische Grenzschutzturm in diesem Komplex ist einer der am besten erhaltenen seiner Art an der lettischen Küste. Leider ist der Zustand der Gebäude schlecht, auf dem Gelände befindet sich ein Gewehrverladeplatz, und es wurden eine Einfahrt und Fragmente von Schützengräben geborgen.
Der Posten der Küstenwache befand sich im Gebäude der ehemaligen Marineschule. In der postsowjetischen Zeit wurden in Teilen der Gebäude Unterkünfte angeboten.
Der zweite Turm des sowjetischen Grenzschutzes befindet sich etwa 400 m vom Strand entfernt, ist aber leider baufällig. Der Bootsfriedhof Mazirbe befindet sich jedoch nur 500 m vom Strandturm entfernt in Richtung Sīkrags.
Küstenverteidigungsbatterie Liepaja 23
Die Batterie befindet sich zwischen der Tobago- und der Marinestraße, seewärts.
Gemäß dem am 5. Oktober 1939 unterzeichneten "Stützpunktabkommen" zwischen der Republik Lettland und der UdSSR sollte in Kurzeme ein Kontingent von fast 25 000 Soldaten der Roten Armee und der baltischen Marine stationiert werden. Bis März 1941 wurden in Lettland baltische Marinestützpunkte in den Verteidigungssektoren der Bucht von Irbe, Saaremaa und Liepaja eingerichtet, die aus Küstenschutzbatterien bestanden.
Zum Küstenschutzsektor von Liepaja gehörte die 208. Artilleriedivision mit zwei 130-mm-B-13-Geschützbatterien (Nr. 23 und Nr. 27) und einer 180-mm-Schienengeschützbatterie. Der Bau der Batterie 23 begann im November 1939 und wurde am 17. Mai 1941 abgeschlossen, wobei teilweise die Stahlbetonbefestigungen der Batterie Nr. 2 der Festung Liepaja genutzt wurden. Die Batterie 23 bestand aus vier Geschützstellungen aus Stahlbeton an der Strandpromenade, einem Gefechtsstand und einem Beobachtungsturm (Entfernungsmesser) im Dünenwald. Die Entfernungsmessstellungen wurden in Stahlbetontürmen untergebracht, um eine bessere Sicht zu gewährleisten und gleichzeitig im Kiefernwald verborgen zu bleiben.
Die Geschützstellungen 1 und 2 liegen direkt am Meer und sind teilweise erodiert, während die Geschützstellung 4 in den Dünen am besten sichtbar ist. Die Batterie 23 wurde am 27. Juni 1941 während des Rückzugs aus Liepāja von sowjetischen Soldaten gesprengt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Batterie 23 in Batterie 636 umbenannt und mit denselben 130-mm-B-13-Kanonen bewaffnet. 1954 wurde jedoch ein neuer Entfernungsmessturm zur Feuerleitung gebaut, der an den Turm von 1941 angrenzte. 1963 wurden alle Geschütze des Küstenschutzes von Liepaja abgebaut.
Nach der Wiederherstellung der Unabhängigkeit Lettlands wird das Gelände der Batterie Nr. 2 vom Verteidigungsministerium genutzt.
Die beiden Türme stehen sehr nahe beieinander - nur 10 m voneinander entfernt. Die vier Geschützstellungen befanden sich rechts von den beiden Türmen, genau genommen an der Strandpromenade. Der Stahlbetonbunker für das Personal, das die Geschütze bemannte, ist heute von den Wellen weggespült und hat ein ausgewaschenes Fundament, das schief steht und sich in Richtung Meer neigt.
Ausstellung zum kulturhistorischen Erbe des Städtchens Seda (1953-1990) und Architektur der Stalinzeit
Die Städtchen Seda wurde ursprünglich als Arbeitersiedlung errichtet, zusammen mit der 1953 entstandenen Torffabrik. Das Gebäude der Torffabrik wurde zu einem Großbauprojekt des Allunions-Komsomol (kommunistische Jugendorganisation) erklärt. Junge Leute aus der ganzen Sowjetunion kamen nach Seda. Sie prägten den Charakter und das Gesicht des Ortes. 1954 wurde Seda rechtlich zu einer Arbeitersiedlung und 1961 zu einer städtischen Arbeitersiedlung erklärt. Am 14. November 1991 erhielt die städtische Siedlung Seda mit ländlicher Umgebung den Status als Stadt mit ländlicher Umgebung.
Im Kulturhaus von Seda ist eine Ausstellung zum kulturellen Erbe zu sehen.
Die Ausstellung zeichnet die Entwicklungsgeschichte von Seda und seiner Umgebung nach, angefangen mit der Zeit, als sich an der Stelle, wo später die Stadt Seda entstand, noch die Ländereien des Bauernhofes „Salānieši“ erstreckten. Dazu gehören Geschichten über die Gründe und den Verlauf der Entstehung der Stadt, die Geschichte der Torfabrik Seda und andere Zeitzeugnisse. Inhaltlich stützt sich die Ausstellung hauptsächlich auf Archivmaterialien - Protokolle, Beschlüsse und Verordnungen. Um einen lebendigen Eindruck von dieser Epoche zu vermitteln, ist der Ausstellungsraum mit einem für die damalige Zeit typisch eingerichteten Funktionärsbüro ausgestattet. Die Ausstellung wird durch Haushaltsgegenstände aus der Sowjetzeit und verschiedene Zeitdokumente in den Vitrinen bereichert.
Ausstellung historischer Zeugnisse aus der UdSSR-Zeit im Heimatmuseum der Gemeinde Tirza
Die Ausstellung, die sich im ehemaligen Disponentenraum der Kolchose befindet, wurde 2005 eröffnet. Besucher sind eingeladen, die Atmosphäre der UdSSR in interaktiven Kursen zu erleben: Sie diskutieren über die Sowjetzeit, erfinden Legenden zu historischen Beweisen, singen im Chor, tanzen „Letkis“, basteln Papierflieger und Tschlapuschkas und überstehen so eine Pause in der Schule. Außerdem können sie Kilavu-Brötchen und Lindenblütentee genießen.
Geschichten und historische Zeugnisse über Traditionen, altes Handwerk und herausragende Persönlichkeiten aus der Region.
Bitte buchen Sie Ihren Besuch im Voraus!
Erwachsene: 2,00 Euro
Studenten, Rentner: 1,00 Euro
Geführte Tour für bis zu 6 Personen (1-1,5 Stunden): 6,00 Euro
Führungen für Gruppen ab 6 Personen (1–1,5 Stunden): 1,00 Euro pro Person
Deutscher Armeebunker aus dem Zweiten Weltkrieg
Es befand sich in der Nähe des Hauses in "Brankša" auf einem Getreidefeld.
Am 2. September 2021 fanden unter der Leitung des Geschichtsbegeisterten der Region Saulkrasti, Andris Grabčiks, und in Abstimmung mit der Pächterin des landwirtschaftlichen Grundstücks, Ines Karlova, Ausgrabungsarbeiten am Bunker der deutschen Armee an der Verteidigungslinie von Sigulda aus dem Zweiten Weltkrieg statt.
„77 Jahre sind seit dem Bau des Bunkers vergangen. Er wurde sowohl von der Sowjetarmee angegriffen als auch von landwirtschaftlichen Maschinen überfahren. Erst vor drei Jahren wurde er teilweise durch schweres Gerät beschädigt. Um zu verhindern, dass der Boden unter Wasser gerät, wurde ein Entwässerungssystem mit einem Wasserspeicher am Eingang angelegt, der bei Bedarf entleert werden konnte. Der Bunkerboden besteht aus runden Baumstämmen mit 10 cm Durchmesser und war mit Stroh bedeckt. Dieser Bunker ist zwar nicht groß, bietet aber ausreichend Platz für etwa sechs Personen. Er ist nicht der einzige Bunker in dieser Gegend, aber einer der wenigen, die gut erhalten geblieben sind.“ – So erzählt Andris Grabčiks über den Bunker.
Nach der Veröffentlichung der Informationen im Internet gingen zwei gescannte historische Fotografien von Jānis Seregins, Historiker und Besitzer des Fahrradmuseums Saulkrasti, ein. Sie trugen die Inschrift „29.08.44, Saulkrasti, Gemeinde Vidriži“ und den Kommentar: „Die Fotografien stammen von einer inzwischen verstorbenen Frau aus Saulkrasti. Ihren Angaben zufolge hatten sich Flüchtlinge aus den Gebieten Pskow und Leningrad, die die Deutschen während des Rückzugs vertrieben hatten, in Saulkrasti niedergelassen. Sie wurden beim Ausheben von Schützengräben an der Verteidigungslinie bei Ķīšupe eingesetzt. Auf einem der Bilder sind Menschen bei der Waldarbeit zu sehen. So wurden Baumstämme gewonnen, die wir heute im Bunker bei Brankšai sehen können. Das zweite Bild zeigt sie bei der Verpflegung an einer Ausgabestelle oder in der im Haus eingerichteten Küche. Ich vermute, es handelt sich um das Sägewerk von Brankšai.“
Der Bunker hat den Zweiten Weltkrieg an der Verteidigungslinie von Sigulda überstanden.
Die Bunkeranlage wurde erstmals im April 2021 vermessen, aufgrund des hohen Grundwasserspiegels konnten jedoch keine Ausgrabungsarbeiten durchgeführt werden.
Der Bunker befand sich auf landwirtschaftlich genutztem Gelände und wurde nach Ausgrabung und Untersuchung wieder zugeschüttet, um die landwirtschaftlichen Arbeiten nicht zu beeinträchtigen.
Filtrationslager für Gefangene der Roten Armee in Grieze und die Kirche von Grieze
Grieze liegt an der lettisch-litauischen Grenze, wo der Fluss Vadakste in den Fluss Venta mündet. Die Kirche von Grieze wurde 1580 erbaut, aber die Gemeinde bestand schon vor 1567. Die Kirche wurde mehrmals umgebaut - 1769, 1845 und 1773 wurde die erste Orgel eingebaut. Sowohl das Altarbild als auch die beiden Glocken sind aus verschiedenen Gründen verloren gegangen.
Im Garten der Kirche befindet sich ein Friedhof, auf dem Angehörige der Kirche und Adelige begraben sind. Einer von ihnen ist der Griezer Organist Friedrich Baris und seine Frau Charlotte, denen ein Denkmal vor der Sakristei der Kirche gesetzt wurde. An der Südseite der Kirche sind 32 schwedische Soldaten begraben, die im Großen Nordischen Krieg gefallen sind. Auf dem Friedhof befinden sich auch die Gräber von 110 deutschen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind und für die 1930 ein Denkmal errichtet wurde.
Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Kirche in Mitleidenschaft gezogen, als Ende Oktober 1944 die Frontlinie entlang des Venta-Flusses verlängert wurde und die 225. deutsche Infanteriedivision in der Nähe der Kirche von Grieze stationiert war. Als die sowjetische 4. Stoßarmee am 19. November 1944 Angriffe über den Venta-Fluss startete, schlugen mehrere Artilleriegranaten in die Südwand der Kirche ein und der Kirchturm wurde schwer beschädigt.
Nach der Kapitulation der Heeresgruppe Kurzeme wurden an der Leningrader Front der Roten Armee 284 171 Menschen gefangen genommen. 7493 waren Soldaten der Roten Armee, die aus deutscher Gefangenschaft entlassen wurden. 48 deutsche Generäle ergaben sich in die Gefangenschaft. Nach den Unterlagen, die bei der Kapitulation der Heeresgruppe Kurzeme vorgelegt wurden, belief sich die Zahl der Soldaten auf etwa 185 000. Der Rest der fast 100 000 Personen, die der Filtration unterworfen wurden, waren Kurzeme-Zivilisten und sowjetische Flüchtlinge, da die sowjetische Leningrader Front am 10. Mai 1945 anordnete, alle Männer zwischen 16 und 60 Jahren der Filtration zu unterwerfen.
Im Gegensatz zu den Streitkräften anderer Länder wurden in der Roten Armee die Kontrolle, die Bewachung, die Pflege und der Schutz der Kriegsgefangenen nicht von den Armeeeinheiten, sondern von den Organen für innere Angelegenheiten - dem Volkskommissariat für Staatssicherheit - durchgeführt. Die Hauptaufgabe der Filterung bestand darin, Bürger der UdSSR und der von der Sowjetunion besetzten Länder aufzuspüren, die auf deutscher Seite an den Feindseligkeiten teilgenommen hatten. Gefangene deutsche Soldaten wurden untersucht, um mögliche Kriegsverbrecher zu ermitteln.
In der Nähe der Kirche von Grieze befand sich vom 10. Mai bis zum 17. Juni 1945 ein Filtrationslager für Kriegsgefangene. Das Lager befand sich wahrscheinlich hier, weil die Kirche von Grieze in der Nähe der Hauptverkehrsstraßen lag. Die Gruben im Boden, in denen sich die Häftlinge in kalten Nächten vor der Kälte versteckten, indem sie sich mit allem Möglichen zudeckten, sind in der Umgebung noch gut zu erkennen. Während dieser Zeit verursachte die Rote Armee erhebliche Schäden im Inneren der Kirche (alle Kirchenbänke wurden entfernt - "für den Kriegseinsatz", die Kanzel wurde beschädigt, die Orgel zerstört usw.). Im Kirchengebäude selbst wurde eine Wäscherei eingerichtet.
Der letzte Gottesdienst in der Kirche fand 1950 statt und die Gemeinde hörte auf zu existieren. Nach der Auflösung der Gemeinde, auch später unter der Aufsicht der lettischen Gesellschaft für Natur- und Denkmalschutz, wurde die Kirche nicht wieder instand gesetzt. Allerdings stand das Gebäude bis in die 1960er-1970er Jahre unter Dach. Die Kirche wurde während des Sturms von 1961 beschädigt, und 1968 wurden die verbliebenen Innenelemente von den Mitarbeitern des Rundāle-Palastes gerettet.
Seit 2003 ist eine Gruppe Gleichgesinnter aus Rigaer Kirchengemeinden an der Sanierung und Restaurierung der Kirche beteiligt. Bis heute wurden die Kirchenmauern konserviert und der Turm restauriert.
Gedenkensemble für die Deportierten "Der Weg des Kreuzes"
Das Gedenkensemble befindet sich an der Skolas-Straße und an der römisch-katholischen Kirche St. Agathe der Berge.
Die Gedenkstätte besteht aus vier stilisierten Waggons, die jeweils für eine andere Zeit der Deportation stehen. Die Dächer der Waggons symbolisieren Häuser. In der Mitte des Ensembles stehen ein Altar und ein Kreuz. Das Denkmal unterscheidet sich von den anderen, weil es daran erinnert, dass lettische Bürger nicht nur am 14. Juni 1941 und am 25. März 1949 deportiert wurden. Es gab auch Deportationen zwischen diesen Daten. Das Denkmal ist so konzipiert, dass die Liste der eingravierten Namen im Zuge der weiteren Forschung erweitert werden kann.
Das Gedenkensemble wurde von der lokalen Künstlerin und Historikerin Maija Eņģele entworfen.
Liepaja Festung Mittlere Festung und Denkmal für die Soldaten der Roten Armee
Die gefährlichste Angriffsrichtung für den Hafen von Kaiser Alexander III. war der Osten zwischen den Seen von Tosmare und Liepāja, wo sich eine 2,5 km breite Landzunge befand. Zur Verteidigung des Landstreifens wurden drei Festungsanlagen errichtet. Am südlichen Ufer des Tosmare-Sees befand sich eine linke Schanze, am nördlichen Ufer des Liepāja-Sees eine rechte Schanze, und zwischen den Schanzen lag das Mittelfort. Das Mittlere Fort war die wichtigste Befestigung der Festung Liepaja, wurde aber nicht vollständig fertiggestellt und die Artillerie wurde erst 1908 eingesetzt.
In der Mittleren Festung fanden die schwersten Kämpfe im April 1915 statt, als deutsche Truppen angriffen, im November 1919 während der Kämpfe der lettischen Armee gegen die westrussische Befreiungsarmee, und im Juni 1941, als Liepāja von der 291.
Im Juni 1941, als die Feindseligkeiten zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion ausbrachen, bestand die Liepaja-Garnison der Sowjetarmee aus Einheiten der Liepaja-Marinebasis der Marine und der Roten Armee. Der Marinestützpunkt Liepaja bestand aus Minentrawler-, Torpedoboot- und U-Boot-Abteilungen, darunter auch ehemalige Schiffe und U-Boote der lettischen Marine. Die Küstenverteidigung wurde von der 23. und 27. Artilleriebatterie mit 130-mm-Geschützen und der 18. Eisenbahnartilleriebatterie mit 180-mm-Geschützen wahrgenommen, die von zwei Zenith-Artilleriedivisionen gedeckt wurden. Zum Stützpunkt gehörten auch mehrere Pionier-, Reparatur-, Verbindungs- und Ausbildungseinheiten mit insgesamt etwa 4 000 Soldaten unter dem Kommando von Hauptmann M. Klevenski, I. Rang. Von den Einheiten der Roten Armee wurde die Garnison von der 67. Gewehrdivision (ohne das 114. Gewehrregiment und eine Artilleriedivision) unter dem Kommando von Generalmajor N. Dedajew besetzt. Vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten hatte die Division etwa 9000 Soldaten. Das 143. Jagdfliegerregiment mit 68 Flugzeugen verschiedener Typen war auf dem Flugplatz Liepāja stationiert. Darüber hinaus operierte die 12. Grenzschutzeinheit im Raum Liepāja.
Die Kampfhandlungen um die Festung Liepaja begannen am frühen Morgen des 24. Juni 1941. Trotz der sowjetischen Verluste gelang es den deutschen Einheiten am 25. Juni nicht, die Festungsmauer von Liepaja zu durchbrechen. Die Kämpfe in Liepāja endeten am 27. und 28. Juni, als sowjetische Einheiten versuchten, nach Norden durchzubrechen.
Ausstellung des Museums Liepaja "Liepaja unter dem Besatzungsregime"
Die Ausstellung des Liepāja-Museums "Liepāja unter dem Besatzungsregime" befindet sich in Liepāja, Klāva Ukstiņa Straße 7/9.
Die Ausstellung umfasst den Zeitraum von 1939 bis 1991 während der doppelten sowjetischen und deutschen Besatzung. Die Einwohner von Liepāja gehörten zu den ersten in Lettland, die den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erlebten, und zu den letzten, für die der Krieg sowohl buchstäblich als auch symbolisch endete.
Erst mit dem Zusammenbruch der UdSSR in den späten 1980er Jahren bot sich die Gelegenheit, die Unabhängigkeit Lettlands wiederherzustellen. Die Lettische Volksfront spielte in diesem Prozess eine wichtige Rolle. Ihre Ausstellung, die am 21. Januar 2001 eröffnet wurde, befindet sich in der ehemaligen Zentrale der Ortsgruppe Liepāja. Die Ortsgruppe Liepāja der Volksfront war mit 13 000 Mitgliedern die zweitgrößte nach der Ortsgruppe Riga. Von hier aus wurden während der Barrikaden im Januar 1991 Busse mit Freiwilligen organisiert, die zur Verteidigung der Stätten in Riga fuhren. Am 23. August 1991, dem Tag des Molotow-Ribbentrop-Paktes, wurde das Lenin-Denkmal, ein Symbol der sowjetischen Macht in der Stadt, abgebaut. In den folgenden Jahren wurden in Deutschland 500 Bronzeglocken daraus gefertigt - Andenken an eine vergangene Zeit. Eine dieser Glocken ist ebenfalls in der Ausstellung zu sehen.
Der Zweite Weltkrieg und die sowjetische Besatzung von Liepāja endeten erst 1994, als die letzten Truppen des Erben der UdSSR, Russland, die Stadt verließen.
Das Museum organisiert regelmäßig thematische Ausstellungen seiner Sammlung und Kunstwerke sowie Vorträge und Treffen mit Historikern und Zeitzeugen der jüngeren lettischen Geschichte. Das Museumsgebäude wird derzeit renoviert und die Ausstellung wird erneuert.
Suchscheinwerferstandort der deutschen Küstenwache in Usi und Grenzschutzposten in Kolka
Am Kap Kolka war keine militärische Infrastruktur geplant, abgesehen von mehreren vorgelagerten Leuchttürmen, die über einen langen Zeitraum hinweg entweder vor dem Ersten Weltkrieg, während des Ersten oder während des Zweiten Weltkriegs wieder aufgebaut wurden. Küstenschutzbatterien wurden für den schmalsten Teil der Irbe-Straße zwischen der Halbinsel Sirves und dem Leuchtturm Michael Tower geplant.
Die einzigen Befestigungsanlagen militärischer Art entstanden Ende 1944, als sich die Heeresgruppe Nord darauf vorbereitete, eine mögliche Landung der sowjetischen Ostseeflotte abzuwehren. Im Frühjahr 1945, nachdem sich das Eis zurückgezogen hatte, verteidigten zwei Batterien der 532. Artilleriedivision die Küste am Kap Kolka. Batterie 7 mit vier 75-mm-Kanonen und drei 20-mm-Zenitkanonen. Batterie 8 mit vier 88-mm-Mörsern, drei 20-mm-Mörsern und einem 81-mm-Mörser. Die Anti-Deserteur-Infanterie-Garnison bestand aus einer der berühmtesten Küstenverteidigungseinheiten der deutschen Marine, der 5. Kompanie der 531st Artillery Division. Obwohl sie dem Namen nach eine Artillerieeinheit war, war sie dem Einsatz nach eine Infanterieeinheit, die ihren Krieg im Juni 1941 in Liepāja begann. Die Einheit war dann auf Inseln im Finnischen Meerbusen stationiert und nahm später an den Kämpfen auf der Insel Saaremaa teil. Die Reste der Division wurden in eine Kompanie umgewandelt und mit sieben Panzerabwehrkanonen und drei 20-mm-Flugabwehrkanonen verstärkt am Kap Kolka stationiert.
Die sowjetische Marinelandung fand nie statt, und die deutschen Einheiten kapitulierten im Mai 1945.
Der Aufbau der militärischen Infrastruktur am Kap Kolka begann nach dem Zweiten Weltkrieg, als hier sowjetische Grenzposten stationiert wurden und Kolka, wie die gesamte Kurzeme-Küste von Mērsrags bis zur litauischen Grenze, zu einer Sperrzone wurde
Betonturm der deutschen Armee (am Strand)
Wenn man 200 m am Hang des Berges Odju entlang geht, kann man mehrere Objekte aus dem Ersten Weltkrieg sehen - alte Betonfundamente von Kanonen. Ein unvollendeter Beobachtungsturm aus Beton steht neben dem Strand, parallel zum Waldweg entlang des Rojas-Pfades. Der genaue Verwendungszweck dieses Objekts ist unbekannt. Unterhalb des Fundaments wurden Nischen für Munition gebaut. Auch tiefe Gruben, ehemalige Unterstände, sind zwischen den Kiefern zu sehen.
Einige der Objekte stammen wahrscheinlich aus dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als deutsche Küstenschutzbatterien in der Gegend stationiert waren. Die 4. Batterie der 532. Artilleriedivision der Marine war mit vier 88-mm-Geschützen, drei 37-mm-Geschützen, einem 20-mm-Geschütz mit vier Läufen und einem 50-mm-Mörser für die nächtliche Beleuchtung ausgerüstet. Zwei 45-mm-Panzerabwehrkanonen sind an der Mündung des Rojas stationiert. Die Stadtgarnison bestand aus Einheiten des 64. und 109. Sappeurbataillons.
Ruinen der Ķērkliņu-Kirche
Die Ruinen der Kirche von Ķerkliņu befinden sich etwa 5 Kilometer nordwestlich von Kokmuiža, in der Nähe des Ķerkliņu-Sees. Die Kirche wurde 1641 von Heinrich von Dönhoff (Derkarth), dem Besitzer des Gutshofs Ķerkliņi, erbaut. Die ursprüngliche Holzkirche wurde durch einen Steinbau ersetzt, unter dem Gräber für die Toten der Familien Dönhof und später Kleist errichtet wurden. Die Gräber wurden bereits während der Unruhen von 1905 zerstört, aber 1949 wurden die Särge von den Gräbern in die Kirche gebracht. Die Kirche war ein Beispiel für den kurzzeitigen Barockstil - ihre Schnitzereien wurden von den Holzschnitzern aus Kuldīga und Liepāja angefertigt. Obwohl die Besitzer des Schlosses und der Kirche zu verschiedenen Zeiten von finanziellen Problemen geplagt waren, wurde die Kirche im Laufe ihres Bestehens mehrmals umgebaut. Sie wurde auch im Ersten Weltkrieg in Mitleidenschaft gezogen, woraufhin die Gemeinde das Mauerwerk 1929 wieder aufbaute und 1934 eine Orgel einbaute. Leider wurde die Kirche während des Zweiten Weltkriegs beschädigt und vieles ging verloren. Es ist daher lobenswert, dass vor dem Wiederaufbau der Kirche im Jahr 1933 viele einzigartige Barockskulpturen fotografiert und inventarisiert wurden und sogar in den Archiven des Denkmalamtes landeten. Mit der Errichtung der Mülldeponie und der Vertreibung der Bewohner wurde die Kirche nie restauriert. Heute sind die Kirchenmauern und der Turm zu sehen.
Denkmal für die gefallenen Helden der Gemeinde Gulbene für die Freiheit Lettlands
Im historischen Zentrum von Gulbene gelegen, gegenüber der evangelisch-lutherischen Kirche von Gulbene.
Denkmal für die Opfer der Unruhen von 1905, die im Ersten Weltkrieg und im Lettischen Unabhängigkeitskrieg gefallenen Mitglieder der Gulbene-Gemeinde sowie die Opfer des Maliena-Tribunals. Das Denkmal wurde von E. Ābeltīns entworfen und 1929 gegenüber der evangelisch-lutherischen Gulbene-Kirche enthüllt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein fünfzackiger Stern auf dem Denkmal angebracht, später – auf dem Sockel – eine Gipsfigur eines sowjetischen Soldaten, die in Bronze gegossen wurde. Hinter dem Denkmal wurde ein Friedhof für gefallene sowjetische Soldaten angelegt. Als 1969 der neue Friedhof für im Zweiten Weltkrieg gefallene sowjetische Soldaten im Spārīte-Park eröffnet wurde, wurden die sterblichen Überreste der Gefallenen dorthin überführt, der Standort des Denkmals jedoch eingeebnet. Im Herbst 1989 wurden die Fundamente des Denkmals freigelegt und die 1928 eingemauerte Kapsel mit der Inschrift geborgen. Das Denkmal wurde 1992 restauriert (Bildhauer O. Feldbergs).
Zwischen dem 24. Dezember 1918 und dem 31. Mai 1919, als das 1. (4.) Valmiera-Infanterieregiment Gulbene von den Bolschewiki befreite, beherbergte die Kirche das Revolutionäre Militärgericht und den Arbeiterklub von Maliena (Vecgulbene). Dessen Tätigkeit zeichnete sich durch die Härte seiner Urteile und die hohe Anzahl an Todesurteilen aus, oft wegen geringfügiger Vergehen – 349 Fälle wurden untersucht, in denen 606 Personen angeklagt waren.
Eine Gedenkskulptur ist zu sehen.
Friedhof der Roten Armee
Das Gebäude befindet sich in der Parka Street 1B, Lubāna, Gemeinde Madona.
Denkmal für die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten der Roten Armee
Die ursprüngliche Begräbnisstätte für Rotarmisten wurde 1944 im Zentrum von Lubāna – an der Kreuzung der Straßen Oskara Kalpaka, Tilta und Baznīcas – festgelegt. 1961, als der Verkehr in der Stadt und ihrer unmittelbaren Umgebung zunahm, wurden die Gräber verlegt und die Gefallenen in der Nähe des Flusses Aiviekste (heutige Kreuzung der Straßen Stacija und Parka in Richtung Aiviekste) umgebettet. Insgesamt sind hier 450 Rotarmisten bestattet. Gedenktafeln mit ihren Namen erinnern an die Gedenkstätte.
Friedhof der Barkava-Brüder
Liegt zwischen den Straßen Brīvības und Parka, in der Nähe des Barkava-Kulturhauses, in der Gemeinde Barkava, Region Madona.
Gedenkstätte für die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten der Roten Arbeiter- und Bauernarmee (Sowjetunion). Beerdigt: 1980 – 659 (alle bekannt und gekennzeichnet); 1984 – 667 (661 bekannt und gekennzeichnet) Soldaten.
Die Botschaft der Russischen Föderation hat in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Madona mehrere Rekonstruktionsarbeiten an den Brudergräbern von Soldaten der Sowjetarmee in der Gemeinde Madona durchgeführt und wird diese auch weiterhin durchführen, unter anderem in der Pfarrei Barkava.
Friedhof der Madona-Brüder
Der Brüderfriedhof in Madona befindet sich auf dem Parka-Hügel in der Nähe der Pumpuru-Straße. Eine Betontreppe führt von der Pumpuru-Straße zum Friedhof, ein Weg führt von der Parka-Straße dorthin.
Das Denkmal wurde 1947 enthüllt.
In dem Massengrab sind mehrere tausend gefallene sowjetische Soldaten bestattet. Der Obelisk, der auf dem Hügel stand, ist nicht erhalten geblieben.
Die Russische Föderation hat Informationen über die Namen und Nachnamen der in diesen Gräbern ruhenden Soldaten zusammengetragen und präzisiert, und die Rekonstruktion der Gräber wurde im Jahr 2021 abgeschlossen. Im Zuge der Rekonstruktion wurden die Namen der gefallenen Soldaten neu auf Marmorplatten eingraviert, die an den Gedenkmauern angebracht wurden.
Beerdigt: 1959 – 46; 1980 – 3941 (alle bekannt und gekennzeichnet); 1984 – 3979 (3943 bekannt und gekennzeichnet) Soldaten, 1 Partisan, 2 sowjetische Aktivisten. PSV: M. A. Ivasiks (1919–1944).
Denkmal für diejenigen, die 1918-1920 für das Vaterland gefallen sind.
Liegt an der Seite der Rīgas-Straße, gegenüber der Burg Krustpils.
In Jēkabpils, am rechten Ufer der Düna, wurde das Denkmal „Den Gefallenen für das Vaterland 1918–1920“ errichtet. Der Vorschlag, ein Denkmal für die im Unabhängigkeitskrieg gefallenen Soldaten zu errichten, stammte vom Krustpilser Zweig des Lettischen Brüderfriedhofskomitees vom 12. Juni 1923. Für die Errichtung des Denkmals übergab der Krustpilser Pfarrgemeinderat dem Brüderfriedhofskomitee am 12. November 1923 einen Teil des Denkmals für Zar Alexander II., das sich in der Nähe des Pfarrgemeinderatsgebäudes befand und an dessen Stelle ein Denkmal zur Erinnerung an die Abschaffung der Leibeigenschaft errichtet worden war. Das lettische Innenministerium genehmigte dem Krustpilser Zweig des Brüderfriedhofskomitees, Spenden zu sammeln. Insgesamt wurden 2.400 Lats gespendet, 1.200 fehlten. Man hoffte, diese durch den Basar und den geselligen Abend am Tag der Denkmalseinweihung aufzubringen.
Das Projekt des Denkmals wurde dem Architekten Aleksandrs Birznieks anvertraut. Dessen Plan sah vor, ein Denkmal aus lokalem Material – Dolomitgestein – zu errichten. Das Denkmal besteht aus zwei konzentrischen, massiven Halbkreisen aus Dolomitgestein. Der äußere Halbkreis ist zur Düna hin niedriger, in den Hang eingelassen und bildet eine Terrasse. In seiner Mitte befindet sich ein rotes Backsteinkreuz. Im Zentrum des Haupthalbkreises wurden als Altar Granitplatten mit der Inschrift „Den Gefallenen für das Vaterland 1918–1920“ und der Darstellung einer über den Wellen der Düna aufgehenden Sonne errichtet, umrahmt von lettischen Schriftzeichen. Den zentralen Teil des Denkmals bildet die Maske eines gefallenen Soldaten, geschaffen vom Bildhauer V. Treijs. Der amtierende Kommandeur des Latgale Artillery Regiments, Oberstleutnant Jākobsons, gestattete die Nutzung eines Platzes am rechten Ufer der Daugava gegenüber der Burg Krustpils für den Bau des Denkmals, unter der Bedingung, dass der Platz im Eigentum des Latgale Artillery Regiments bleibe.
1925 schloss die Krustpilser Zweigstelle des Lettischen Brüderfriedhofskomitees einen Vertrag mit dem Geschäftsmann V. Treija aus Riga über den Bau eines Denkmals in Krustpils. Am 26. Juli 1925 wurde der Grundstein gelegt. Der 27. September 1925 ist ein Feiertag für die Einwohner von Krustpils. Das Denkmal wurde enthüllt und geweiht. Die Weihe wurde vom lutherischen Pfarrer der Krustpilser Gemeinde, K. Skujiņš, vollzogen. Unter den Anwesenden waren Kriegsminister R. Bangerskis, der Kommandeur des Artillerieregiments Latgale, Oberst Kire, General K. Berķis und weitere. Für den Bau des Denkmals wurden elf kubische Kalksteinblöcke verwendet, die in der Nähe von Asote abgebrochen worden waren.
In den 1950er Jahren wurde das Denkmal „Den Gefallenen für das Vaterland 1918–1920“ teilweise zerstört – der obere Teil wurde abgerissen, die Masken alter lettischer Soldaten und die Inschriften wurden beschmiert, das Feuerkreuz zerstört. Bereits zu Beginn der Dritten Volksbewegung forderten Aktivisten des Krustpilser Ortsverbands der Lettischen Volksfront (LTF) auf den ersten Bezirkskonferenzen der LTF die Wiederherstellung des Denkmals in Krustpils. Am 11. November 1989 fand am Standort des Denkmals eine Gedenkfeier statt, bei der die Bevölkerung von Jēkabpils ihrer Gefallenen gedachte.
Anfang 1992 begannen die Restaurierungsarbeiten am Denkmal. Granitblöcke in der benötigten Größe und Form wurden im kommunalen Betrieb Cēsis gefertigt. Die Bearbeitung des Granits erfolgte nach den Zeichnungen von E. Nīmanis und V. Treikmanis. Die technische Bauleitung der Restaurierung übernahm die Architektin Māra Steķe. In Riga goss die Bildhauerin Inta Berga die Bronzeteile des Denkmals. Alle Arbeiten wurden aus Mitteln der Stadt Jēkabpils finanziert. Das restaurierte Denkmal wurde am 18. November 1992 von Modris Plāte, dem damaligen Dekan der evangelisch-lutherischen Gemeinde Jēkabpils und Krustpils, und Jānis Bratuškins, dem Pfarrer der katholischen Gemeinde Jēkabpils, geweiht.
Es wurde am 27. September 1925 in Krustpils eingeweiht. Das Denkmal wurde vom Architekten Alexander Birzenieks entworfen. Die Inschrift „Für die Gefallenen, selbst für das Vaterland 1918–1920“ ist eingraviert. 1941 wurde das Denkmal von den sowjetischen Besatzungsbehörden teilweise zerstört und um 1950 vollständig vernichtet. Am 18. November 1992 wurde es restauriert.
Herrenhaus und Park Remte
Das Schloss Remte (deutsch: Remten) ist ein Herrenhaus in Remte. Die Gebäude und der Park von Schloss Remte sind nationale Denkmäler. Im Herrenhaus ist die Grundschule Remte untergebracht. Das Schloss Remte wurde im Jahr 1800 im Stil des Berliner Klassizismus für den damaligen Gutsbesitzer Graf Karl Medem erbaut.
Am Ende des Zweiten Weltkriegs war die 19. Division der Lettischen Legion der deutschen Heeresgruppe auf Gut Remte und in seiner Umgebung stationiert.
Virga Manor Antiquitätenlager
Das Gutshaus Virga beherbergt eine Antiquitätensammlung. Hier erhalten Sie einen Einblick in das Leben der Kuren am Ufer der Vārtāja und in Virga, in das Gut Virga und die Familie Baron Nold sowie in die Zeit des Zweiten Weltkriegs und der sowjetischen Kolchose in Virga. Sie können die Objekte nicht nur betrachten, sondern auch Geschichten über Themen hören, die Besucher interessieren.
Das Gut Virga überstand die Schlacht im Kessel von Kurzeme 1944/45 so gut, dass man bei einem Spaziergang über das Gelände noch immer die Atmosphäre vergangener Zeiten und die Anwesenheit der einstigen Bewohner spüren kann. Ein Moment der Ruhe am Denkmal für den schwedischen König Karl XII., „Karls Stiefel“, oder an einem der eigens dafür eingerichteten Rastplätze in der Nähe des Virgaer Traditionshauses dient nicht nur der Entspannung, sondern erinnert auch daran, dass Karl XII. den Winter 1701 genau hier – in Virga – verbrachte.
In der ehemaligen Herrenscheune, die heute das Haus der Kultur und häuslichen Traditionen der Einheimischen beherbergt, können Sie eine Sauna und Räume für Feierlichkeiten aller Art, einschließlich Hochzeiten, mieten.
Goldfisch-Geschichtsarchiv
Liegt in der Gemeinde Zeltiņi, Gemeinde Alūksne.
Besuche müssen im Voraus vereinbart werden.
Eine Reise durch die Zeit. Uniformen verschiedener Armeen, die „rote Ecke“ und Alltagsgegenstände erzählen die Geschichte des sowjetischen und vorsowjetischen Lebens in Lettland. Ein Klassenzimmer – ein Zeitzeuge aus dem Leben von Schülern verschiedener Epochen. Für diejenigen, die diese Zeit miterlebt haben, bietet sich die Gelegenheit, in Erinnerungen zu schwelgen, für die jüngere Generation, die Welt in einem anderen Licht zu sehen. Das Zeltiņi-Museum wurde 2007 als Ort der Bewahrung sowjetischen Erbes gegründet.
Hier erfahren Sie außerdem mehr über die Geschichte der von Pfarrer Ernst Gliks gegründeten Schule, über die Lebensgeschichten der Dorfbewohner und über das Leben des Dorfbewohners Edgars Liepiņš.
Es wird eine Besichtigung des Raketenstützpunkts der sowjetischen Armee angeboten.
Zu besichtigende Ausstellungen:
„Jüngste Vergangenheit“ (Uniformen verschiedener Armeen, „rote Ecke“, Haushaltsgegenstände);
„Zimmer der Einheimischen“ (vorsowjetisches Leben),
"Meine Schule in Zeltiņi" (eine Schulklasse – ein Augenzeuge des Lebens von Schülern zu verschiedenen Zeiten).
„Der Nordstern – Edgars Liepiņš“ entstand dank der Unterstützung der Fans von Lettlands Witzkönig Nr. 1. Zeltiņi ist der Geburtsort von Edgars Liepiņš.
Besuchsgebühr:
2,00 EUR; Studenten und Senioren 1,00 EUR;
Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Besuch: +371 25745577.
Arbeitszeit
Montag-Dienstag - geschlossen
Mittwoch – 9:00–17:00 Uhr
Donnerstag-Freitag - geschlossen
Samstag - 9:00-17:00 Uhr
Sonntag – geschlossen
Private Militärsammlung in Mundigciems
Private Militärsammlung in Mundigciems. Aivars Ormanis sammelt seit vielen Jahren historische Gegenstände - Militäruniformen, Uniformen, Tarnungen, Kommunikationsgeräte, Haushaltsgegenstände, Schutzausrüstungen aus verschiedenen Epochen und Ländern, die auf den Zweiten Weltkrieg, die Sowjetarmee und die Wiederherstellung des unabhängigen Lettlands zurückgehen.
Die Sammlung wird derzeit nicht gut gepflegt und die Exponate sind in einer ehemaligen Scheune einer Kolchose untergebracht.
Zollhaus Ezere - Sammlung kulturhistorischer und heimatkundlicher Zeitzeugnisse
Das Zollhaus Ezere liegt unweit der Landstraße Saldus-Mažeikiai an der lettisch-litauischen Grenze. Am 8. Mai 1945 wurde in diesem Gebäude von den Befehlshabern der im Kurland-Kessel eingeschlossenen deutschen Heeresgruppe Kurland die Kapitulationsurkunde unterzeichnet. Daher kann man das Ende des Zweiten Weltkrieges in Ezere verorten. Die Ausstellung im alten Zollhaus informiert über die Ereignisse am Ende des Zweiten Weltkrieges sowie über die historische Entwicklung der Umgebung von Ezere von der Vor- und Frühgeschichte bis in unsere Tage. Am Morgen des 7. Mai 1945 stellte der Befehlshaber der Leningrader Front, Marschall L. Goworow, ein Ultimatum an die Befehlshaber der Heeresgruppe Kurland und forderte sie auf, die Waffen niederzulegen. Die Kapitulationsakte wurde am 8. Mai von beiden Seiten unterzeichnet und das weitere Vorgehen vereinbart: die Orte der Waffenübergabe, der Umfang der vorzulegenden Dokumente und Informationen sowie weitere Maßnahmen praktischer Natur.
Karosta orthodoxe St.-Nikolaus-Seekathedrale
Die orthodoxe St.-Nikolaus-Kathedrale am Meer ist die visuelle und spirituelle Dominante von Karosta und steht in starkem Kontrast zu den daneben errichteten Hochhaus-Plattenbauten. Die Kirche wurde nach dem Prinzip der russisch-orthodoxen Kirchen des 17. Jahrhunderts mit einer zentralen und vier Seitenkuppeln entworfen und gebaut.
Eine repräsentative Kathedrale war bereits bei der Planung des Hafenkomplexes durch Zar Alexander III. vorgesehen, doch hatte zunächst die Hafeninfrastruktur Vorrang. Eine provisorische orthodoxe Kirche war von Anfang an im Bereich des Hafenkrankenhauses in Betrieb.
Mit dem Bau der St.-Nikolaus-Seekathedrale wurde 1900 nach einem Entwurf des Architekten Wassili Kasjakow begonnen, der anderen Sakralbauten des Russischen Reiches jener Zeit sehr ähnlich war. Die Kathedrale wurde am 22. August 1903 in Anwesenheit des russischen Zaren Nikolaus II. und seiner Familie eingeweiht. Bis 1915 war die Kathedrale Schauplatz aller feierlichen Veranstaltungen der russischen Armee und Marine, einschließlich des Gottesdienstes des 2. Pazifikgeschwaders im Jahr 1904, bevor es in den Fernen Osten segelte, wo es in der Schlacht von Tsushima zerstört wurde.
Nach 1915, als Liepāja von deutschen Truppen besetzt wurde, behielt die Kathedrale ihren sakralen Status und zum Teil auch ihre Ausstattung, und es wurden dort seltene Gottesdienste abgehalten.
Nach der Besetzung von Liepāja durch die lettische Armee auf dem Gebiet der Karosta diente die Kathedrale bis 1934 weiterhin als orthodoxe Kirche, bis sie in eine lutherische Kirche für die Liepāja-Garnison umgewandelt wurde. Die Kirche wurde umgestaltet, wobei auch die Kreuze ersetzt wurden, und die drei großen Konfessionen - lutherisch, katholisch und orthodox - konnten dort Gottesdienste abhalten. Ein orthodoxer Altar wurde in der Kathedrale beibehalten, und in den späten 1930er Jahren wurde eine in der VEF hergestellte elektrische Orgel für die evangelischen Gottesdienste installiert.
Während der sowjetischen Militärbasis in den Jahren 1939-1941 verlor die Kathedrale ihren sakralen Status, und während des Zweiten Weltkriegs wurde das Gebäude auch von verschiedenen deutschen Einheiten genutzt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg richteten die sowjetischen Marinestützpunktbehörden in der Kathedrale einen Matronenklub ein, und das Gebäude wurde für seine neue Funktion umgebaut.
Im September 1991, noch zu Zeiten der Russischen Föderation, wurde die Kathedrale unter ihrem historischen Namen restauriert und der orthodoxen Kirche übergeben. Der erste Gottesdienst wurde am 19. Dezember 1991 zu Ehren des Heiligen Nikolaus abgehalten. Im September 2016 wurden die restaurierten Glocken der Kathedrale geweiht.
Gedenkstätte für die Soldaten der Roten Armee "Pieta" in der Gemeinde Nīkrāce
Der sowjetische Soldatenfriedhof befindet sich an der Straße Skrunda - Embute - Priekule, die auf einer Hochebene zwischen den beiden Flüssen Dzelda im Süden und Koja im Norden liegt. Mehr als 3000 Gefallene sind hier begraben.
Schlachten des Zweiten Weltkriegs
Die Rote Armee startete am 27. Oktober 1944 eine Offensivoperation, die heute als 1. Kurland-Bataillon bekannt ist, mit dem Ziel, die deutsche Heeresgruppe "Nord", später in "Kurland" umbenannt, zu vernichten. Bis zum 5. November erreichten die sowjetische 61. Armee und Teile der 6. Gardearmee und der 4. Schockarmee den Fluss Zeld und einige Einheiten der 5. Vor dem nächsten Angriff wurde die 2. Gardearmee der 1. Baltischen Front in diesen Sektor verlegt, um die Eisenbahnlinie Skrunda-Liepaja zu erreichen. Nachdem die erste Invasion gelungen war, wurde der Angriff auf Kuldīga von der 5.
Der Beginn der 2. Kurlandschlacht verzögerte sich witterungsbedingt und begann erst am 19. November. Die Roten Armeen erzielten ihre größten Erfolge in der Nähe des heutigen Brüderfriedhofs, und am Abend des 24. November hatten das 1. und 60. Schützenkorps den Placdarm am Nordufer des Flusses Koj eingenommen. Der Erfolg der Roten Armee endete jedoch dort. Die Heeresgruppe Nord sah die Richtung der sowjetischen Angriffe voraus und konzentrierte hier entsprechende Kräfte, darunter zwei Panzerdivisionen.
Am Abend des 26. November 1944 wurden die Angriffe der Roten Armee gestoppt und bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurden keine weiteren Versuche unternommen, die deutschen Kräfte in Kurland zu vernichten. In den folgenden Kämpfen ging es darum, die Evakuierung der deutschen Armee aus Kurland zu verhindern.
Morgenfriedhof
Nachdem der Flugplatz 1953 auf Wunsch des Verteidigungsministeriums der UdSSR in diesem Gebiet eingerichtet worden war, befanden sich die Zvārde-Kirche, die Ķerkliņi-Kirche und der Rīteļi-Friedhof im Zentrum des Polygons - neben einem künstlichen Flugfeld mit Zufahrtsstraßen und Verteidigungsstellungen, das von sowjetischen Piloten als Ziel genutzt wurde. Die Flugzeuge flogen von Flugplätzen in Lettland und in der Sowjetunion hierher. In weniger als 40 Jahren wurden die Kirche, der Friedhof, das ehemalige Herrenhaus und Dutzende von umliegenden Gebäuden zu Ruinen. Heute wird das Gelände von der Saldus-Martin-Luther-Kirche verwaltet. Die Umgebung ist immer noch mit Blindgängern verseucht und es kann gefährlich sein, abseits der Straßen zu gehen.
Die Barbarei erreichte 1988 ihren Höhepunkt, als der Rīteļi-Friedhof mit seinen Gräbern und Denkmälern mit Bulldozern überrollt wurde.
Am 21. Juli 1990 fand in Saldus eine der ersten Aktionen statt, bei denen die lettische Bevölkerung den Abzug der UdSSR-Armee aus dem Gebiet von Zvārde forderte. Die Teilnehmer der Kundgebung durften den Polygon betreten, räumten den Friedhof ein wenig auf und gruben weiße Kreuze aus.
Die Deponie wurde bis 1992 weiter genutzt, und noch im März 1992 stürzte ein aus Lielvārde startendes Flugzeug aus unbekannten Gründen in der Deponie ab. Die lettischen Verteidigungskräfte begannen im Mai 1993, nach dem Abzug der russischen Armee, mit der Entminung der Deponie. Im Jahr 2008 stellten die Einwohner von Zvārde auf dem Friedhof von Rīteļi einen Gedenkstein mit der Aufschrift "Verzeiht uns, dass wir nicht..." auf.
Südfestung der Festung Liepaja und Denkmal für N. Dedaev, Kommandeur der 67. Schützendivision der Roten Armee
Die südliche Festung von Liepaja befindet sich im südwestlichen Teil von Liepaja, zwischen der Klaipėda-Straße und dem Strand.
Zum Schutz des Hafens von Kaiser Alexander III. wurde eine Festung geplant, die zwei Kilometer von der Südgrenze der Stadt entfernt liegen sollte. Die Festung sollte zwischen dem Liepāja-See und dem Meer, westlich der Mündung des Donnerflusses, errichtet werden, wobei die Stahlbetonbefestigung durch einen Graben verstärkt werden sollte. Obwohl die Befestigungsanlagen fast vollständig fertiggestellt waren, waren die Waffen noch nicht eingesetzt worden. Die errichteten Keller wurden sowohl während des Ersten als auch während des Zweiten Weltkriegs als Lagerräume genutzt. In den 1920er und 1930er Jahren befanden sich verschiedene Fabriken auf dem Festungsgelände. Im Gegensatz zur mittleren Festung und zum Ravelin hat die südliche Festung nie am Krieg teilgenommen, da die Angreifer in allen Kriegen das Ostufer des Liepāja-Sees belagerten und versuchten, in Liepāja zwischen dem Tosmare- und dem Liepāja-See einzudringen.
Nördlich der Südfestung liegt der größte Friedhof von Liepāja, der Zentralfriedhof. Im südlichen Teil des Friedhofs befindet sich ein Friedhof der Roten Armee, auf dem sowjetische Soldaten bestattet sind, die in der Nähe von Liepāja gefallen sind, darunter der Kommandeur der 67. Gewehrdivision, Generalmajor Nikolai Dedajew, der die Verteidigung von Liepāja im Juni 1941 leitete.
Mazbānītis-Wanderweg in Nordkurland
Die Mazbānīte ist die Bezeichnung für einen Zug in Nordkurzeme, der zwischen 1916 und 1963 Passagiere und Güter auf einer 600 mm breiten Schmalspurbahn transportierte. Sie ist ein Erbe der Militärgeschichte aus dem Ersten Weltkrieg und spielte einst eine bedeutende Rolle für den kulturellen und wirtschaftlichen Wohlstand ganz Nordkurzemes, insbesondere aber der livischen Fischerdörfer, indem sie eine Verbindung zwischen den Siedlungen herstellte und Arbeitsplätze schuf.
Der Naturlehrpfad führt von Mazirbe nach Sīkrag entlang der ehemaligen Schmalspurbahnstrecke Stende–Ventspils, die von den Einheimischen auch „Mazbānīša-Strecke“ genannt wird. Der Bau der Bahnlinie begann 1916 und sie war bis 1963 in Betrieb. Die Schmalspurbahn verband die Hafenstadt Ventspils mit den Küstenfischerdörfern Dundags und dem großen Eisenbahnknotenpunkt Stende und trug so zum wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung der Region zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg bei.
Während der Sowjetzeit war die Küste eine „Sperrzone“, wodurch Küstendörfer wirtschaftlich isoliert wurden und ihre Bevölkerungszahl sank. Auch die Existenz neu errichteter, geheimer Militäranlagen trug dazu bei, dass der Eisenbahnverkehr in den 1960er Jahren eingestellt wurde.
Der Wanderweg besteht aus einer kleinen Schleife von 15 km und einer großen Schleife von 19 km.
GPX-Karte hier verfügbar:
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/dabas-takas/mazbanisa-dabas-taka/
Entfernungsmesser Nr.1 der 23. Küstenbatterie (1941)
Die Entfernungsmesser (aus dem Jahr 1941) befinden sich in den Kiefern der Düne, nur 10 m von dem anderen Turm entfernt, der 1954 gebaut wurde. Die 1. und 2. Geschützstellung der Küstenbatterie befinden sich auf der Strandpromenade und sind teilweise erodiert, während die 4. Geschützstellung am besten in den Dünen zu sehen ist. Der Stahlbetonbunker für das Personal, das die Geschütze bemannt hat, ist heute von den Wellen weggespült und hat ein ausgewaschenes Fundament, das schief steht und sich gegen das Meer neigt.
Die Festungsbatterie 2 von Liepaja sollte weiter von der Küste entfernt gebaut und durch einen hohen Wall geschützt werden. Die Bewaffnung der Batterie sollte aus 16 11-Zoll-Mörsern (280 mm) des Modells 1877 bestehen. Die Mörser hatten eine steile Flugbahn und mussten nicht direkt ausgerichtet werden.
Nach dem am 5. Oktober 1939 zwischen der Republik Lettland und der UdSSR unterzeichneten "Basisabkommen" sollte ein Kontingent von fast 25 000 Soldaten der Roten Armee und der baltischen Marine in Kurzeme stationiert werden. Bis März 1941 wurden in Lettland baltische Marinestützpunkte in den Verteidigungssektoren der Bucht von Irbe, Saaremaa und Liepāja eingerichtet, die aus Küstenschutzbatterien bestanden.
Zum Küstenverteidigungssektor von Liepaja gehörte die 208. Artilleriedivision mit zwei 130-mm-B-13-Geschützbatterien (Nr. 23 und Nr. 27) und einer 180-mm-Schienengeschützbatterie. Der Bau der Batterie 23 begann im November 1939 und wurde am 17. Mai 1941 abgeschlossen, wobei teilweise die Stahlbetonbefestigungen der Batterie Nr. 2 der Festung Liepaja genutzt wurden. Die Batterie 23 bestand aus vier Geschützstellungen aus Stahlbeton an der Strandpromenade, einem Gefechtsstand und einem Beobachtungsturm (Entfernungsmesser) im Dünenwald. Die Entfernungsmessstellungen befanden sich in Stahlbetontürmen, um eine bessere Sicht zu gewährleisten und gleichzeitig im Kiefernwald verborgen zu bleiben.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Batterie 23 in Batterie 636 umbenannt und mit denselben 130-mm-B-13-Kanonen bewaffnet. 1954 wurde ein neuer Entfernungsmessturm für die Feuerleitung gebaut, der an den Turm von 1941 angrenzte. Im Jahr 1963 wurden alle Geschütze des Küstenschutzes von Liepaja abgebaut.
Nach der Wiederherstellung der Unabhängigkeit Lettlands wird das Gelände der Batterie Nr. 2 vom Verteidigungsministerium genutzt.
Entfernungsmesser Nr. 2 der 23. Küstenbatterie (1954)
Der Entfernungsmesser (von 1954) befindet sich in den Kiefern einer Düne, 10 m vom Entfernungsmesser von 1941 entfernt. Die Geschützstellungen des 1. und 2. Geschützes der Küstenbatterie befinden sich auf der Strandpromenade und sind teilweise erodiert, während die Geschützstellung des 4. Geschützes am besten in den Dünen zu erkennen ist.
Die Festungsbatterie 2 von Liepaja sollte weiter von der Küste entfernt gebaut und durch einen hohen Wall geschützt werden. Die Bewaffnung der Batterie sollte aus 16 11-Zoll-Mörsern (280 mm) des Modells 1877 bestehen. Die Mörser hatten eine steile Flugbahn und mussten nicht direkt anvisiert werden.
Nach dem am 5. Oktober 1939 zwischen der Republik Lettland und der UdSSR unterzeichneten "Basisabkommen" sollte ein Kontingent von fast 25 000 Soldaten der Roten Armee und der Baltischen Marine in Kurzeme stationiert werden. Bis März 1941 wurden in Lettland in den Verteidigungssektoren der Bucht von Irbe, Saaremaa und Liepāja baltische Marinestützpunkte eingerichtet, die aus Küstenschutzbatterien bestanden.
Der Küstenverteidigungssektor von Liepaja umfasste die 208. Artilleriedivision mit zwei 130-mm-B-13-Geschützbatterien (Nr. 23 und Nr. 27) und einer 180-mm-Schienengeschützbatterie. Der Bau der Batterie 23 begann im November 1939 und wurde am 17. Mai 1941 abgeschlossen, wobei zum Teil die Stahlbetonbefestigungen der Batterie Nr. 2 der Festung Liepaja verwendet wurden. Die Batterie 23 bestand aus vier Geschützstellungen aus Stahlbeton an der Strandpromenade, einem Gefechtsstand und einem Beobachtungsturm (Entfernungsmesser) im Dünenwald. Die Entfernungsmessposten wurden in Stahlbetontürmen untergebracht, um eine bessere Sicht zu gewährleisten und gleichzeitig im Kiefernwald verborgen zu bleiben.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Batterie 23 in Batterie 636 umbenannt und mit denselben 130-mm-B-13-Kanonen bewaffnet. 1954 wurde neben dem Turm von 1941 ein neuer Entfernungsmesser-Turm für die Feuerleitung gebaut. Im Jahr 1963 wurden alle Küstenschutzkanonen von Liepaja abgebaut.
Nach der Wiederherstellung der Unabhängigkeit Lettlands wird das Gelände der Batterie Nr. 2 vom Verteidigungsministerium genutzt.
Standort "Dunce's Bunker", Gedenktafel "Patriotic Hawks"
Der "Duncs-Bunker" mit der Gedenktafel "Patriotische Falken" befindet sich in der Gemeinde Otaņķu, an dem Ort, an dem sich der erste Bunker der Partisanengruppe der nationalen Widerstandsorganisation "Patriotische Falken" befand.
Im Winter 1945/46 gründeten im Dorf Ķīburi in der Gemeinde Barta drei patriotische Männer unter der Leitung von Alfred Tilib (einem ehemaligen Legionär der 19. SS-Division) die nationale Widerstandsbewegung "Tēvijas Hawks", die bald etwa 200 Mitglieder aus verschiedenen Orten zählte: Liepāja, Aizpute, Nīca, Dunika, Grobiņa, Barta, Gavieze. Diese Bewegung kämpfte für die Befreiung Lettlands.
Der Bunker, in dem die Partisanen untergebracht waren, war 4 x 4 m groß und bestand aus dicken, horizontal verlegten Holzstämmen. Man betrat ihn von oben durch eine Falltür, aus der eine kleine Kiefer herauswuchs, unter der sich eine Leiter befand. Die Luken befanden sich auf zwei Etagen mit jeweils einem Schlafplatz für 7-8 Männer. Leider wurde der Bunker im Jahr 1947 entdeckt und gesprengt.
Heute ist an der Stelle, an der sich der Bunker befand, eine Vertiefung im Boden zu sehen. Die Stätte liegt im Wald und ist jederzeit und ohne Voranmeldung frei zugänglich.
In der Nähe gibt es einen Picknickplatz mit einer Schutzhütte.
Die Gedenktafel wurde am 9. September 2005 enthüllt. Die Granitstele wurde vom lettischen Nationalen Partisanenverband in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nīca, der Forstwirtschaft Barta und der Grundschule Rudes errichtet.
Das Objekt hat den Status eines kulturellen und historischen Denkmals der Region.
Antikensammlung von Otaņķi
Das Museum Otanki befindet sich im Hof der ehemaligen Rude-Schule.
Die Erzählung des Führers über den Duncis Bunker und seine Schöpfer, ihr weiteres Schicksal. Ein Modell des von den Schülern der ehemaligen Rude-Schule erstellten Bunkers (nach eigener Erzählung der Partisanen) und eine räumliche Karte des damaligen Waldgebiets mit markierten Häusern von Unterstützern und Kontakten können eingesehen werden. Bunkerhaushaltsexponate gesammelt.
Voranmeldung per Telefon 26323014 oder E-Mail lelde.jagmina@gmail.com.
Zeugnisse des Zweiten Weltkriegs im Aizvīķi-Park
Der Gutspark Aizvīķi befindet sich in Aizvīķi, Gemeinde Gramzda, nur wenige Kilometer von der litauischen Grenze entfernt.
Im Aizvīķi-Park sind die Standorte von Bunkern und Schützengräben aus dem Zweiten Weltkrieg noch deutlich sichtbar. Eine der Waffenarten war das Raketenwerfersystem „Katyusha“. Mehrere solcher Raketenwerfersysteme befanden sich auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Aizvīķi-Park, und diese Anlagen (Kaponiere) sind in der Natur gut erkennbar.
Dieser einzigartige, von Geheimnissen und Legenden umwobene Waldpark entstand Ende des 19. Jahrhunderts als Aizvīķi-Gutspark, als der Gutsherr von Korf das nahegelegene Hügelland mit einem Kiefern- und Fichtenwald bepflanzte. Später wurden auf dem 40 Hektar großen Gelände Spazierwege angelegt, weitere Baumarten gepflanzt und ein Fasanengehege eingerichtet.
Neben den malerischen Waldlandschaften gibt es auch hölzerne Märchen- und Legendenfiguren sowie Steinskulpturen, die Reisenden von Ereignissen aus der Geschichte von Aizvīķi erzählen und die kulturellen und historischen Stätten im Park kennzeichnen. Der Park ist zudem als „Grüne Zone“ zertifiziert.
Um das kulturelle und historische Erbe des Aizvīķi Manor Parks besser zu erkunden, empfehlen wir die Inanspruchnahme der Dienste eines Führers.
Bunker und Kaponnieren der Roten Armee im Aizvīķi-Park
Der Gutspark Aizvīķi befindet sich in Aizvīķi, Gemeinde Gramzda, nur wenige Kilometer von der litauischen Grenze entfernt.
Im Aizvīķi-Park sind die Standorte von Bunkern und Schützengräben aus dem Zweiten Weltkrieg noch deutlich sichtbar. Ein Bunker der Roten Armee wurde im Park restauriert.
Eine der Waffenarten im Zweiten Weltkrieg war das Katjuscha-Raketenwerfersystem. Mehrere solcher Raketenwerfersysteme befanden sich im Aizvīķi-Park, und noch heute sind diese Anlagen (Kaponiere) in der Natur deutlich sichtbar.
Um das kulturelle und historische Erbe des Aizvīķi Manor Parks besser zu erkunden, empfehlen wir die Inanspruchnahme der Dienste eines Führers.
Denkmal für das Artillerieregiment von Hauptmann J. Ozols
An der Straße Riga - Liepāja in der Gemeinde Džūkste, etwa einen Kilometer von der Gedenkstätte für die Verteidiger von Kurzeme entfernt, wurde eine Gedenktafel für die 7. Batterie der 3. Division unter dem Kommando von Major Jānis Ozols aufgestellt.
Während der Dritten Kurlandschlacht vom 23. bis 31. Dezember 1944 wehrte die III. Division unter Major J. Ozols die überlegenen Angriffe des Feindes ab und verhinderte so einen Frontdurchbruch. In dieser Schlacht bewies Major J. Ozols persönlichen Heldenmut und Führungsqualitäten.
Jānis Ozols (1904-1947) war Offizier der lettischen Armee und der lettischen Legion, Träger der Ehrenschnalle der Armee sowie nationaler Partisan und Opfer sowjetischer Repression.
Militärerbepfad von Misiņkaln
Der Naturpark Misiņkalns befindet sich in der Stadt Aizpute. Misiņkalns ist der höchste Ort in der Stadt Aizpute. Seine Höhe erreicht 95,4 m. Die Spitze bietet einen malerischen Blick auf die Stadt. Mit dem Bau des Naturparks Misiņkalns wurde im 20. Jahrhundert begonnen. anfangs. Die Fläche des Parks beträgt derzeit etwa 28 ha.
Auf dem Territorium des Parks gibt es mehrere Orte und Denkmäler, die mit den Ereignissen des 20. Jahrhunderts verbunden sind - die Gedenkstele der in den lettischen Freiheitskriegen gefallenen Soldaten - die Kavaliere des Lāčpleš-Ordens, der Ort des Holocaust-Mahnmals, die Ort der Erinnerung an die Unterdrückten und die Gedenktafel der gefallenen roten Partisanen.
Im Park können Sie die Pflanzen und Plantagen verschiedener seltener Arten kennenlernen und die unberührte Natur genießen. Derzeit ist der Park von renovierten Wander- und Radwegen durchzogen, und auf dem Territorium des Parks befindet sich eine Motorradstrecke, auf der lettische Motocross-Wettkämpfe stattfinden.
Um das kulturelle und historische Erbe des Gutsparks von Misiņkaln besser kennenzulernen, empfehlen wir Ihnen, die Dienste eines Fremdenführers in Anspruch zu nehmen.
Fabrik "Kurzeme tsela"
In Aizpute gründete Ģertrūde Lindberga im Jahr 1890 eine Kartonfabrik.
Während des Zweiten Weltkriegs befanden sich auf dem Fabrikgelände deutsche Werkstätten zur Reparatur von militärischer Ausrüstung und Waffen.
Nach dem Krieg wurde der Industriekomplex des Bezirks Aizpute gegründet, der landwirtschaftliche Geräte herstellte. Außerdem gab es Webereien, Färbereien und Wollverarbeitungsbetriebe. Später wurde auch eine Möbelwerkstatt eröffnet.
Die Schloss- und Eisenwarenfabrik „Aizpute“ wird in Metallbeschlagfabrik „Kurzeme“ oder MFR „Kurzeme“ umbenannt.
Die MFR "Kurzeme" wurde in eine Aktiengesellschaft "Kurzemes atslėga 1" umgewandelt und begann mit der Herstellung verschiedener Arten von Sondermetallprodukten, die sie bis heute erfolgreich produziert.
Wir empfehlen Ihnen, an einer Führung durch die Fabrik teilzunehmen. In der Fabrik befindet sich die Fotoausstellung „Sowjetisches Aizpute“.
Grab der Nationalen Partisanenbrüder „Dzelzkalni“
Auf dem Friedhof wurde ein Denkmal zum Gedenken an die Partisanen errichtet. Die Namen der Partisanen der Partisanengruppe Puze-Piltene sind in den Stein eingraviert. Die Granitplatte am Fuße des Denkmals trägt die Jahreszahlen (1945–1953) und die Namen von 36 gefallenen Partisanen.
Am 23. Februar 1946 fand in der Gemeinde Tārgale bei Vārnuvalkas eine blutige Schlacht zwischen der lettischen Partisanengruppe unter Kommandant Brīvnieks in ihrem Lager und einer Zerstörereinheit der sowjetischen Besatzungsarmee statt. Sechs Partisanen fielen in der Schlacht und wurden von Anwohnern heimlich im Wald begraben. Später wurden zwei weitere, erschossene Männer dort ohne Gerichtsverfahren oder Verurteilung beigesetzt. Dieser Teil des Waldes wurde in der Gegend als Dzelzkalns-Friedhof bekannt und war viele Jahre lang nur Kennern an dem Kreuz in der Fichte zu erkennen.
Im Sommer 1989 stellten Mitglieder des Ugāle-Zweigs der Lettischen Nationalen Befreiungsarmee (LNNK) Birkenkreuze auf der nationalen Gräberstätte der Puze-Piltene-Gruppe der am 23. Februar 1946 Gefallenen im Gebiet Dzelzkalni im Wald von Zūri auf und suchten in Lettland und im Ausland nach Angehörigen der Gefallenen.
Am 27. April 1991 wurden die Gräber unter Beteiligung von Angehörigen der Gefallenen und Vertretern nationaler Organisationen aus mehreren Ländern von Theologieprofessor Roberts Akmentiņš geweiht und erhielten den Namen „Gräber der Brüder Dzelzkalni“.
Küstenartillerie-Batterie Nr. 2 von Liepāja
Unter den zahlreichen Objekten des Marinemuseums Liepāja ist die Küstenartilleriebatterie Nr. 2 von Liepāja nach wie vor der geheimnisvollste Ort in Liepāja. Die Batterie Nr. 2 war stets mit Munitionsdepots für die Truppen der verschiedenen damaligen Mächte ausgestattet.
Die Batterie Nr. 2 der Festung Liepāja lag weiter von der Küste entfernt und war durch eine hohe Befestigungsmauer geschützt. Sie war mit 16 280-mm-Mörsern des Modells von 1877 bewaffnet. Nach der Demontage der Festung wurden hier Munitionsdepots eingerichtet. Aufgrund der Explosionsgefahr war das Gelände 130 Jahre lang für die Öffentlichkeit gesperrt und bewacht. Heute beherbergt es eine Ausstellung über die Aktivitäten des Hauptquartiers der 1. Kurischen Division von 1919 bis 1940 sowie über fotografische Zeugnisse des 1. Infanterieregiments Liepāja, des 2. Infanterieregiments Ventspils und des Kurischen Artillerieregiments.
Denkmal für das 8. Estnische Schützenkorps der Roten Armee
Das Denkmal für die Soldaten des 8. Estnischen Schützenkorps der Roten Armee befindet sich bei den Ruinen des Halbguts Kaulači etwa 100 Meter südwestlich der Straße.
Am 17. März 1945 begann der letzte Offensivversuch der Roten Armee in Kurland. Die 7. estnische Schützendivision des 8. estnischen Schützenkorps hatte die Aufgabe, die Eisenbahnlinie Riga-Liepaja westlich des Bahnhofs Blidene zu erreichen und den Angriff des 3. mechanisierten Gardekorps in Richtung Gaiki zu sichern. Am Abend des 17. März erreichte das 354. Schützenregiment durch den Wald die Eisenbahnlinie südlich des Halbguts Kaulači und setzte seine Angriffe in nordwestlicher Richtung fort, bis es die Häuser von Pikuliai erreichte. Im Halbgut Kaulači und weiter nordöstlich befanden sich die deutschen Burg-Stellungen, die von einzelnen Einheiten der 329. Infanterie-Division verteidigt wurden. Den ganzen Tag des 18. März wurden die Angriffe des 354. Schützenregiments erfolglos fortgesetzt.
Am Abend des 18. März wird das 354. Schützenregiment durch das 27. Die Vorhut der 7. mechanisierten Brigade des 3. mechanisierten Gardekorps, das 1. motorisierte Bataillon mit einer Panzerkompanie, sollte ebenfalls für den Angriff eingesetzt werden. Am Abend des 19. März eroberten die Sowjets in einem konzentrierten Angriff das Halbmausoleum Kaulauchi und nahmen einen Teil der von den Deutschen errichteten Verteidigungslinie auf der dominierenden Anhöhe ein.
Bis Ende März 1945 wurden die Angriffe des 8. estnischen Schützenkorps und des 3. mechanisierten Korps in Richtung Wikstraute und Remte fortgesetzt, jedoch ohne Erfolg.
Während der Kämpfe beherbergte das Halbschloss Kaulači verschiedene Ebenen von Hauptquartieren, und im Mai 1975 wurde an dieser Stelle ein Gedenkstein enthüllt.
Bunker der nationalen Partisanengruppe von Pēteris Čevers
Der Bunker der nationalen Partisanen von Peter Chever befindet sich in der Gemeinde Lauciene, etwa 4 km von der Straße Talsi-Upesgrīva entfernt. Ein mit Holzspänen bedeckter Weg führt zum Bunker. Der renovierte 31 Quadratmeter große Bunker besteht aus einem Betonrahmen, der mit Halbscheiten aus Holzstämmen verkleidet ist, um ein authentisches Gefühl zu vermitteln.
Die Gruppe von Hauptmann Chever stellte den Bunker in den Wäldern bei Vangzene Ende Oktober 1949 fertig. Er sollte den Winter 1949-50 überstehen. Am 3. Februar 1950 verriet der örtliche Förster die Partisanen und der Bunker wurde von einer Tscheka-Einheit mit mehr als 300 Soldaten angegriffen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 19 Personen im Bunker - 17 Männer und zwei Frauen. Sechs Partisanen fielen in diesem ungleichen Kampf, aber den anderen gelang es, zwei Ketten der Tscheka-Belagerung zu durchbrechen, indem sie sich den Weg freikämpften. Am Ende des Winters flüchteten die Partisanen mit ihren Anhängern in umliegende Häuser, doch im Frühjahr fand die Gruppe wieder zusammen, bis sie im November 1950 gefangen genommen und zerstört wurde. Nach einem Angriff von Tscheka-Truppen wurde der Bunker gesprengt, und bevor er wieder aufgebaut werden konnte, blieb nur eine mit Wasser gefüllte Grube übrig.
Polizeigebäude von Liepaja oder "Blaues Wunder"
In Liepāja befand sich die Miliz, eine Institution des kommunistischen Besatzungsregimes, in einem Gebäude in der Republikas-Straße 19, das die Bevölkerung Liepājas seit seiner Errichtung zu Beginn des 20. Jahrhunderts als „Blaues Wunder“ bezeichnete. Das Hauptquartier der Tscheka hingegen lag in der Toma-Straße 19. Kurz nach der Besetzung erhielt es den Beinamen „Rotes Wunder“.
Im Zuge der bisherigen Ermittlungen zu den Verbrechen des kommunistischen Regimes wurde festgestellt, dass weder im Gebäude der Liepāja-Tscheka (dem sogenannten „Roten Wunder“) noch im Gefängnis selbst Hinrichtungen oder außergerichtliche Hinrichtungen stattfanden. Alle Häftlinge, die sich aufgrund des Ausbruchs der Kampfhandlungen auf lettischem Gebiet ab dem 23. Juni 1941 dort befanden, wurden in Gefängnisse in Russland verlegt. Dies betraf sowohl Häftlinge, die wegen sogenannter „politischer“ Verbrechen verhaftet worden waren, als auch Straftäter, unabhängig davon, ob gegen sie ermittelt wurde oder sie bereits verurteilt waren.
Die Überführung der Gefangenen erfolgte gemäß Erlass Nr. 2455/M des Volkskommissars für Staatssicherheit der UdSSR, Wsewolod Merkulow, vom 23. Juni 1941, der an die Chefs des NKGB der Lettischen SSR, der Estnischen SSR und mehrerer Regionen der Ukrainischen SSR gerichtet war. Der Grund für die Erschießungen war entsetzlich und tragisch: Die Gefangenen konnten nicht mehr nach Russland überführt werden, durften aber nicht am Leben gelassen werden. Infolgedessen kam es während des Krieges auch in Liepāja zu außergerichtlichen Erschießungen von Einwohnern, ähnlich wie im Zentralgefängnis Riga, im Gefängnis Valmiera, bei den Milizlagern Valka und Rēzekne sowie in Greizā kalns bei Ludza. Das erwähnte Verbrechen ereignete sich im „Blauen Wunder“ – dem Milizgebäude in Liepāja in der Republikas-Straße 19.
Gedenkstein für die Verteidiger der Festung von Kurzeme
Gelegen in der Region Tukums, an der Autobahn A9, 500 m von der Abzweigung nach Lesteni in Richtung Riga entfernt.
Das Denkmal wurde 1991 in der Nähe der Häuser von Rumbu errichtet, die Schauplatz heftiger Kampfhandlungen waren. Es ehrt die Verteidiger der „Festung Kurland“, die im Zweiten Weltkrieg gegen die Rote Armee kämpften. Die Kämpfe waren von Bedeutung, da sie die vollständige Besetzung Lettlands durch die Rote Armee vorübergehend unterbrachen. Etwa 300.000 Letten emigrierten, um den Verbrechen des Sowjetregimes an der Zivilbevölkerung zu entkommen.
Am Ende des Zweiten Weltkriegs hatte sich auf dem Gebiet Lettlands eine besondere Situation entwickelt. Deutsche Truppen waren in Kurland stationiert, das die Rote Armee zu vernichten oder an Kämpfen in Ostpreußen und um Berlin zu hindern versuchte. Die Kampfhandlungen in Kurland von 1944 bis 1945 werden gemeinhin als „Festung Kurland“ bezeichnet. Die „Schlacht um Kurland“ war der Kampf der deutschen Wehrmacht gegen die massiven Angriffe der Roten Armee. Die Festung Kurland hörte kurz nach der Kapitulation Deutschlands auf zu existieren.
Heute können Sie die Gedenkstätte und Ruhestätte besuchen, die seit der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Lettlands bei lettischen Legionären sehr beliebt war.
Denkmal zur Erinnerung an jene Menschen, die im Herbst 1944 über die Ostsee nach Schweden flohen
Die Gedenkstätte befindet sich auf der Landzunge von Puise, direkt an der Ostsee.
Im Jahr 1944 flohen fast 80.000 Menschen vor der einmarschierenden Roten Armee in den Westen, viele von ihnen auf dem Seeweg. Das Denkmal wurde von Aivar Simson zum Gedenken an diesen großen Exodus geschaffen. Die Idee stammte von Heidi Ivask, die einst selbst am Strand von Puise auf dem Arm ihrer Mutter zusammen mit Hunderten von anderen Flüchtlingen auf ein Boot wartete. Die Gedenkstätte wurde unter der Schirmherrschaft der Organisation "Eesti Memento Liit" errichtet.
Sammlung der Schlachttrophäen der Aiviekste-Furt
Die Aiviekste River Battle Trophy Collection befindet sich in der Gemeinde Kalsnava, Region Madona, auf dem Bauernhof "Kamenes". Sie wurde 2006 von Aivars Klušs gegründet.
Am 10. August 1944 überquerte das 341. Garde-Schützenregiment der Sowjetarmee, einschließlich des 130. Lettischen Schützenkorps, den Fluss Aiviekste. Vom 2. bis 6. August 1944 griffen sie in Richtung Medņi-Antuži an und erreichten das linke Ufer der Aiviekste. Am 7. und 8. August 1944 nahmen Einheiten des 130. Lettischen Schützenkorps erfolgreich am Angriff der sowjetischen 22. Armee auf Krustpils teil. Nach der Einnahme von Krustpils überquerten Einheiten des 130. Korps am 10. August erneut die Aiviekste und errichteten einen Brückenkopf am rechten Flussufer. Darauf folgte die Schlacht um Vietalva, die vom 17. bis 24. August dauerte und mit der Einnahme von Vietalva endete.
Die Anzahl der in der Sammlung ausgestellten Trophäen ist umfangreich – Geschosse, Granaten, Handgranaten, Bajonette, Munitionskisten, Dosen, Fässer, Haushaltsgegenstände.
Es gibt auch Exponate von anderen Schlachtfeldern und aus dem Ersten Weltkrieg.
Denkmal für die Opfer des Kampfes gegen die sowjetische Besatzung und die kommunistische Unterdrückung in der Gemeinde Zebrene
Am 1. September 1995 wurde im Renģe Manor Park der Gemeinde Zebrene ein Denkmal für die Kämpfer gegen das sowjetische Besatzungsregime und die Opfer der kommunistischen Repression eingeweiht. Auf einem groben Felsblock ist ein Kreuz eingraviert, und die Worte lauten: „Den Opfern des roten Terrors von Zebrene, den gefallenen nationalen Kämpfern des Zweiten Weltkriegs.“ Die Errichtung des Denkmals wurde finanziell von der Organisation „Daugavas Vanagi“ unterstützt.
Der Brüderfriedhof der Īle-Nationalpartisanen auf dem Virkus-Friedhof in der Pfarrei Bērze
Der Nationalfriedhof der Partisanenbrüder von Īle auf dem Friedhof Virkus der Gemeinde Bērze wurde am 14. November 1992 errichtet, als hier 15 Partisanen beigesetzt wurden, die am 17. März 1949 in der Schlacht um Īle gefallen waren. Dies war möglich, nachdem die Nationalgarde am 18. Juli 1992 gemeinsam mit der Organisation „Daugavas Vanagi“ und der lettischen Forschungsgruppe für Geschichte „Ziemeļblāzma“ sowie unter Beteiligung von Vertretern anderer national orientierter Organisationen die sterblichen Überreste von 15 lettischen und litauischen Partisanenbrüdern exhumiert hatte, die in einem gesprengten Partisanenbunker im Waldgebiet Īle der Gemeinde Zebrene bestattet waren.
Der Gedenkstein für die im Kampf um Īle gefallenen Partisanen wurde am 29. Mai 1993 enthüllt. Er wurde von Alfons Kalniņš („Edgars“) entworfen, einem der Überlebenden der Schlacht vom 17. März 1949. Die regelmäßig geformte Granitplatte zeigt ein Schwert und eine aufgehende Sonne und trägt die Namen von 15 gefallenen Partisanen sowie die Inschrift:
„Die Sonne ging aus dem Schwert auf. Hier ruhen die lettischen und litauischen Partisanen, die in der Schlacht von Īle am 17. März 1949 gefallen sind.“
Der Grabstein des nationalen Partisanen Bruno Druķis, der 1941 fiel, auf dem Friedhof Jaunsesava in der Gemeinde Naudīte.
Grabstein für Bruno Druķis, einen Partisanen aus der Gemeinde Naudīte, der am 30. Juni 1941 in einem Gefecht mit den bewaffneten Verbänden der sowjetischen Besatzungsbehörden fiel. Eine Granitstele mit der Inschrift: „Dem Partisanen Bruno Druķis gewidmet. Gefallen am 30. Juni 1941. Dieses Land ist ein heiliges Erbe unseres Volkes. Und gesegnet sei, wer für ihn fällt. Gemeinde Naudīte.“ Das Keramikmedaillon mit dem Porträt von B. Druķis wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört.
Nach Beginn des deutsch-sowjetischen Krieges versammelten sich am 27. Juni 1941 etwa zehn örtliche Wachleute im Wald von Ružēni und bildeten unter der Führung von Žanis Gelsons eine nationale Partisaneneinheit. Am folgenden Tag besetzten die Partisanen das Gemeindebüro von Naudīte sowie die örtliche Maschinen- und Pferdevermietung und nahmen die dortigen Traktoren, Landmaschinen und Pferde in Besitz. Am 30. Juni versuchte die Partisaneneinheit aus Naudīte, eine Kolonne von Rotarmisten unter Führung zweier Offiziere auf der Straße bei Meļļi abzufangen. Bei dem Gefecht fielen die beiden sowjetischen Offiziere sowie der pensionierte Korporal Bruno Druķis vom lettischen Kavallerieregiment.
Denkmal für lettische und litauische Nationalpartisanen in der Gemeinde Ukru
Die Gedenkstätte für lettische und litauische Nationalpartisanen in der Nähe der ehemaligen Pfarrschule von Ukru wurde am 21. Oktober 2006 eröffnet und geweiht. Dort wurde ein weißes Kreuz errichtet, an dessen Fuß eine Granitstele mit den Namen zweier lettischer und zweier litauischer Nationalpartisanen und der Inschrift „Für Dich, Vaterland. Den Nationalpartisanen der Pfarrei Ukru 1944–1954. Im Kampf gegen das kommunistische Besatzungsregime fielen am 26. Oktober 1948 Eidis-Eduards Ozols, Kristaps Siļķe, Alfonsas Bugnius und Kostas Norvaitis in der Pfarrei Ukru.“
Die Gedenkstätte wurde vom Lettischen Nationalen Partisanenverband (LNPA) in Zusammenarbeit mit dem Litauischen Freiheitskämpferverband (LLKS) errichtet. An der Eröffnung nahmen der Vorsitzende des Gemeinderats von Ukru, Ainārs Āriņš, der Vorsitzende des LNPA, Ojārs Stefans, der Vertreter des LLKS, Jons Čepons, und weitere Anwesende teil.
Der Grabstein des 1941 gefallenen Nationalpartisanen Harijs Günters auf dem Friedhof Ūziņi Prieži in der Gemeinde Zaļenieki
Grabstein für den Partisanen Harijs Ginter aus der Gemeinde Jēkabnieki, der am 28. Juni 1941 fiel. Eine Gedenktafel mit folgender Inschrift befindet sich auf dem Grab: „Harijs Ginter. Geboren am 30. August 1912. Gefallen für sein Vaterland am 28. Juni 1941. Liebe Mutter, was du weinst, lösche den Schmerz, schlaf ein. Vergebens, vergebens wartest du auf deinen Sohn, vergebens vergießt du bittere Tränen.“ Der Grabstein wurde 2016 und 2024 auf Initiative von Gunita Kulmane, der Leiterin der Bibliothek Ūziņi der Gemeinde Zaļenieki, und auf ihre persönlichen Kosten restauriert.
In den Tagen nach Ausbruch des Deutsch-Sowjetischen Krieges am 22. Juni 1941 wurde in der Gemeinde Jēkabnieki eine nationale Partisaneneinheit unter der Führung des Wachtzugskommandanten V. Ritums aufgestellt, um für Ordnung zu sorgen und die sowjetische Besatzungsmacht zu beenden. Die anfänglich schwache Bewaffnung – einige Pistolen und Gewehre – wurde durch Beutewaffen von Rotarmisten ergänzt, die bei Kalnanši und anderswo gefangen genommen worden waren. Am 28. Juni 1941 kam es bei Gudēni zu einem größeren Gefecht mit sowjetischen Verbänden, bei dem der Wachmann der Gemeinde Jēkabnieki und nationale Partisan H. Gīnters gefangen genommen und zu Tode gefoltert wurde.
Denkmal für die Verteidiger von Jelgava gegen die sowjetische Besatzung im Jahr 1944 im Grēbner Park
Die Gedenkstätte für die Teilnehmer der Verteidigungskämpfe von Jelgava gegen die zweite sowjetische Besatzung im Juli/August 1944 wurde am 8. Mai 1995 eröffnet. Zu diesem Anlass fand ein Gottesdienst in der Evangelisch-Lutherischen St.-Anna-Kirche in Jelgava statt, gefolgt von einer Prozession mit Fahnen durch die Stadt. Auf dem Gelände befindet sich eine unregelmäßig geformte Granitstele mit einem eingemeißelten Kreuz, das in eine Schwertspitze übergeht. Links daneben ist ein Granitblock in Form eines Quaderstumpfs mit der Inschrift „Den Verteidigern von Jelgava 1944, 28.7.–8.8.“ aufgestellt, der an eine Möwe erinnert.
Der Krieg in Jelgava begann, nachdem sowjetische Truppen am 27. Juli 1944 Šiauliai in Litauen erobert und ihre Offensive nach Norden fortgesetzt hatten. Um die Rote Armee zurückzuschlagen, erklärte der neu ernannte Militärkommandant von Jelgava, Generalleutnant Johann Flugbeil, die Stadt zur „Festung“ und befahl, alle verfügbaren Kräfte zu ihrer Verteidigung einzusetzen. Anfangs bestand der Kern der Verteidiger Jelgavas lediglich aus Soldaten der 15. Lettischen SS-Waffendivision (Ausbildungs- und Reservebrigade) unter Oberstleutnant Herman Jurko und einigen wenigen kleinen deutschen Einheiten. Am Nachmittag des 27. Juli begann die sowjetische 3. Luftarmee mit der Bombardierung Jelgavas. Dabei wurden nicht nur strategische militärische Ziele in der Stadt und ihrem Umland – der Bahnhof und die Straßen – angegriffen, sondern auch Wohnhäuser in Brand gesetzt. Gebäude und Zivilbevölkerung der Stadt litten unter dem Beschuss von Katjuscha-Raketenwerfern, Artillerie und Mörsern beider Kriegsparteien.
Am 28. Juli griffen Einheiten des sowjetischen 3. Garde-Mechanisierten Korps die südlichen Vororte der Stadt an, jedoch ohne Erfolg. Am Morgen des 30. Juli wurde der Angriff durch die 279. und 347. Schützendivision der 51. Armee verstärkt. Obwohl Radio Moskau am nächsten Tag die Einnahme der Stadt meldete, war es den sowjetischen Truppen mit Verstärkung lediglich gelungen, ins Stadtzentrum vorzudringen, es aber nicht vollständig einzunehmen. Das rechte Ufer der Lielupe und der befestigte Brückenkopf an der Driksa-Brücke blieben unbesetzt. Auch in der Burg Jelgava, die Anfang August unter sowjetische Kontrolle geriet, fanden heftige Kämpfe statt. Die Rote Armee brachte Kanonen in die Burg und beschoss von den Fenstern aus die Stellungen deutscher und lettischer Soldaten an der Kalnciema-Straße. Daraufhin folgte Gegenfeuer der deutschen schweren Artillerie, das die Burg vollständig zerstörte. Am 4. August gelang es den Verteidigern von Jelgava mit Verstärkung aus Riga, die Stadt vorübergehend unter ihre Kontrolle zu bringen. Drei Tage später zwang jedoch eine massive sowjetische Offensive die deutschen und lettischen Soldaten, Jelgava aufzugeben.
Denkmal für die Teilnehmer der Widerstandsbewegung der 1. Mittelschule von Jelgava, die vom sowjetischen Besatzungsregime in der Meiju-Straße 9 unterdrückt wurde.
Die Gedenkstätte für die Mitglieder der Jugendwiderstandsorganisation der 1. Sekundarschule von Jelgava, die 1941 vom kommunistischen Regime unterdrückt wurden, wurde 2007 auf Initiative des sozialpolitischen Aktivisten und Historikers Andris Tomašūns errichtet. An der Gedenkstätte nahe des 1. Gymnasiums von Jelgava (heute Technische Hochschule Jelgava) wurde eine Eiche gepflanzt und ein Gedenkstein mit folgender Inschrift aufgestellt: „Gedenkeiche für die Schüler des Gymnasiums Jelgava, Teilnehmer der nationalen Widerstandsbewegung – jene, die 1940–1948 in Sibirien starben. T. Bergs, V. Einfelds, A. Gaišs, I. Leimanis, J. Liepiņš, J. Jegermanis, I. Kārkliņš, O. Ošenieks, F. Skurstenis, A. Saldenais, A. Valkīrs, J. Valūns. 2000. O. Valkīrs, V. Treimanis und 1. Gymnasium“.
Die studentische Widerstandsorganisation „Freies Lettland“ in Jelgava wurde am 30. September 1940 von sechs Elftklässlern der 1. Mittelschule Jelgava in der Wohnung von Fričas Skurstenis in der Slimnīcas-Straße 11-4 heimlich gegründet. Die Organisation wurde von Juris Valūns geleitet und zählte etwa 20 Mitglieder. Sie trafen sich in illegalen Versammlungen, um die Struktur und die Aktivitäten der Organisation zu besprechen. Die Jugendlichen druckten den antisowjetischen Slogan „Bereitmachen!“, von dem am 14. Oktober 100 Exemplare in der Stadt verteilt wurden. Vom 25. Oktober bis zum 6. November 1940 verhafteten sowjetische Sicherheitsbehörden dreizehn Schüler der 1. Mittelschule Jelgava, die im Gefängnis von Jelgava inhaftiert und lange verhört wurden. 1941. Im Jahr 1942 wurden die Inhaftierten in die UdSSR gebracht, wo sie am 7. Februar 1942 von einer Sondersitzung des Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten der UdSSR zu zehn Jahren Haft verurteilt wurden. Nur Voldemārs Treimanis überlebte und kehrte nach Lettland zurück, während die anderen Mitglieder der Widerstandsorganisation der 1. Mittelschule von Jelgava in den Jahren 1942/43 in Gulag-Lagern starben.
Gedenktafel für die Widerstandskämpfer der 1. Sekundarschule von Jelgava, die vom sowjetischen Besatzungsregime unterdrückt wurden, in der Akademijas-Straße 10
Eine Gedenktafel für die Mitglieder der vom kommunistischen Regime unterdrückten Jugendwiderstandsorganisation der 1. Sekundarschule Jelgava (ehemals Hercogs-Pēteris-Gymnasium) wurde am 24. Oktober 1996 von der Jelgava-Ortsgruppe des Lettischen Verbandes Politisch Unterdrückter angebracht. Ursprünglich befand sich die Tafel im Inneren des Ģ.-Elias-Jelgava-Museums für Geschichte und Kunst, wurde aber nach der Renovierung der Fassade und der Räumlichkeiten in den Jahren 2007–2008 an die Außenwand des Museums rechts vom Haupteingang verlegt, neben Gedenktafeln für andere historische Persönlichkeiten. Der auf der Gedenktafel eingravierte Text lautet: „Am 26. Oktober 1940 wurden Schüler des Hercogs-Jēkabs-Gymnasiums verhaftet und nach Sibirien deportiert – Mitglieder der antisowjetischen Bewegung „Freies Lettland“ T. Bergs, V. Einfelds, A. Engurs, A. Gaišs, J. Jegermanis, I. Kārkliņš, I. Leimanis, J. Liepiņš, O. Ošenieks, A. Saldenais, F. Skurstenis, V. Treimanis, A. Valkīrs, J. Valūns.“
Die studentische Widerstandsorganisation „Freies Lettland“ in Jelgava wurde am 30. September 1940 von sechs Elftklässlern der 1. Mittelschule Jelgava in der Wohnung von Fričas Skurstenis in der Slimnīcas-Straße 11-4 heimlich gegründet. Die Organisation wurde von Juris Valūns geleitet und zählte etwa 20 Mitglieder. Sie trafen sich in illegalen Versammlungen, um die Struktur und die Aktivitäten der Organisation zu besprechen. Die Jugendlichen druckten den antisowjetischen Slogan „Bereitmachen!“, von dem am 14. Oktober 100 Exemplare in der Stadt verteilt wurden. Vom 25. Oktober bis zum 6. November 1940 verhafteten sowjetische Sicherheitsbehörden dreizehn Schüler der 1. Mittelschule Jelgava, die im Gefängnis von Jelgava inhaftiert und lange verhört wurden. 1941. Im Jahr 1942 wurden die Inhaftierten in die UdSSR gebracht, wo sie am 7. Februar 1942 von einer Sondersitzung des Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten der UdSSR zu zehn Jahren Haft verurteilt wurden. Nur Voldemārs Treimanis überlebte und kehrte nach Lettland zurück, während die anderen Mitglieder der Widerstandsorganisation der 1. Mittelschule von Jelgava in den Jahren 1942/43 in Gulag-Lagern starben.
Das Gebäude der Jelgava-Sekundarschule Nr. 2 in der Filozofu-Straße 50, in dem 1945 Mitglieder der Jugendwiderstandsorganisation „Drei-Sterne-Kolonne“ lernten.
Das Gebäude der heutigen Pauls-Bendrup-Grundschule (ehemals Schule für Gehörlose und Stumme) in der Filozofu-Straße 50 beherbergte nach der Zerstörung Jelgavas im sowjetisch-deutschen Krieg im Juli/August 1944 und der anschließenden zweiten sowjetischen Besetzung die zweite Jelgavaer (Mädchen-)Mittelschule. Im Herbst 1945 besuchten dort mehrere Mitglieder der Jugendwiderstandsorganisation „Drei-Sterne-Kolonne“ die Schule.
Im November 1945 verhafteten sowjetische Sicherheitsbehörden 20 Mitglieder dieser Organisation, zumeist erst 16 oder 17 Jahre alt, darunter 13 Jungen und sieben Mädchen, sowie zwei weitere ihrer Unterstützer. Die Jugendlichen aus Jelgava wurden beschuldigt, illegale Treffen und antisowjetische Agitation organisiert, Waffen und Munition gesammelt, Gefangene im Filterlager der Zuckerfabrik mit Lebensmitteln versorgt, Partisanen in Litauen unterstützt und weitere Verbrechen gegen das sowjetische Besatzungsregime begangen zu haben.
Das Militärbezirksgericht des Baltischen Raums verurteilte am 23. Mai 1946 19 Mitglieder der Drei-Sterne-Kolonne zu zehn Jahren Haft in Gulag-Lagern und fünf Jahren Freiheitsbeschränkung. Nach neun Jahren Haft in Perm, Beresniki, Norilsk und Karaganda konnten sie ein Jahr nach Stalins Tod 1954 in ihre Heimat zurückkehren.
Der Brüderfriedhof für lettische Soldaten, die 1944 bei der Verteidigung von Bauska gegen die sowjetische Besatzung gefallen sind, befindet sich auf dem Butki-Friedhof der Gemeinde Codes.
Die Gedenkstätte auf dem Friedhof von Butki entstand, nachdem die Ortsgruppe Bauska des Umweltschutzvereins im Herbst 1988 die Gräber von etwa 30 lettischen Soldaten, die 1944 in den Kämpfen um die Verteidigung von Bauska gefallen waren und in zwei Kolonnen bestattet waren, gereinigt und beschlossen hatte, ein Denkmal zu errichten. Es folgte eine Spendenaktion für den Bau des Denkmals. Das aus rotem Granit gefertigte Denkmal, das den hier begrabenen Soldaten des Freiwilligenbataillons Bauska gewidmet war, wurde am 25. November 1989 enthüllt, jedoch bereits in der Nacht vom 4. auf den 5. Dezember 1990 von der sowjetischen Besatzungsarmee gesprengt. 1992 wurde anstelle des Denkmals ein massives Holzkreuz errichtet. Am 13. Oktober 2002 wurde ein neues Granitdenkmal, ähnlich dem zuvor zerstörten, enthüllt, das die Inschrift trägt: „Für die Freiheit Lettlands – Gefallene von 1944“.
Gedenkstein für das Freiwilligenbataillon Bauska im Jumpravmuiža-Park der Gemeinde Mežotne
Die Gedenkstätte für das Freiwilligenbataillon Bauska im Jumpravmuiža-Park wurde 1990 auf Initiative von Imants Zaltiņš, einem ehemaligen Soldaten dieses Bataillons, errichtet. Sie befindet sich an der Stelle, wo lettische Soldaten Ende Juli 1944 die ersten Einheiten der Roten Armee am Überqueren des Flusses Lielupe hinderten. Eine weiße Marmortafel mit der Inschrift „Am 28.7.1944 befand sich hier der Gefechtsstand des Freiwilligenbataillons Bauska“ ist an einem grob behauenen Felsblock angebracht. Ursprünglich befand sich anstelle der Marmortafel eine Bronzetafel mit einer Inschrift, die jedoch in den 1990er Jahren von Metalldieben gestohlen wurde.
Ende Juli 1944, als sich die sowjetischen Truppen Bauska näherten, befanden sich keine nennenswerten deutschen Streitkräfte mehr in der Stadt, die sich bis vor Kurzem weit im Hinterland befunden hatte. Der sofortige Fall Bauskas wurde durch das entschlossene Eingreifen von Major Jānis Uļuks, dem Leiter des Bezirks Bauska und Kommandeur des Garderegiments, verhindert. Er hatte Ende Juli das Freiwilligenbataillon Bauska aufgestellt, bestehend aus Angehörigen der Garde des 13. Garderegiments Bauska, Polizisten und Freiwilligen. Das Bataillon bezog Verteidigungsstellungen am Ufer der Lielupe in Jumpravmuiža gegenüber der Insel Ziedoņi und musste bereits am ersten Tag gegen die angreifende Rote Armee kämpfen. Während der Kämpfe schloss sich dem Bataillon auch eine Gruppe litauischer Polizisten an, die sich von Litauen nach Lettland zurückgezogen hatten. Viele Litauer fielen im Kampf, weil sie tapfer und ohne Rücksicht auf Verluste kämpften. Als erstes Opfer wurde ein litauischer Polizeihauptmann getötet, der direkt dort im Jumpravmuiža-Park neben den Gräbern deutscher Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg begraben wurde.
Denkmal für die Verteidiger von Bauska gegen die sowjetische Besatzung im Jahr 1944 im Schlossgarten
Das Denkmal für die Verteidiger von Bauska im Jahr 1944 wurde am 14. September 2012 auf Initiative des ehemaligen Soldaten des Freiwilligenbataillons Bauska, Imants Zeltiņš, und mit dessen und der finanziellen Unterstützung der lokalen Regierung enthüllt. Die Stele aus rotem Granit, die auf einem dreistufigen Betonsockel steht, trägt die Inschrift: „Den Verteidigern von Bauska gegen die zweite sowjetische Besatzung 1944, 28.07.–14.09.“ und „Lettland muss ein lettischer Staat sein. Kārlis Ulmanis.“ Die Enthüllung des Denkmals löste Proteste der russischen und belarussischen Außenministerien sowie lokaler russischer Medien aus. Im Frühjahr 2012 wurde das Denkmal sogar von Vandalen beschädigt. Trotzdem findet jedes Jahr am 14. September um 14:00 Uhr eine Gedenkveranstaltung für die Verteidiger von Bauska an diesem Ort statt.
Ende Juli 1944, als sich die sowjetischen Truppen Bauska näherten, befanden sich keine nennenswerten deutschen Streitkräfte mehr in der Stadt, die sich bis vor Kurzem weit im Hinterland befunden hatte. Der sofortige Fall Bauskas wurde durch das entschlossene Eingreifen von Major Jānis Uļuks, dem Leiter des Bezirks Bauska und Kommandeur des Garderegiments, verhindert. Er hatte Ende Juli das Freiwilligenbataillon Bauska aufgestellt, bestehend aus Angehörigen der Garde des 13. Garderegiments Bauska, Polizisten und Freiwilligen. Das Bataillon bezog Verteidigungsstellungen am Ufer der Lielupe in Jumpravmuiža gegenüber der Insel Ziedoņi und musste bereits am ersten Tag gegen die angreifende Rote Armee kämpfen. Anfangs war das Bataillon sehr schlecht bewaffnet, und die meisten seiner automatischen Waffen mussten als Beute erbeutet werden. Wenige Tage später schlossen sich auch die lettischen Polizeibataillone 23, 319-F und 322-F dem Kriegseinsatz an. Bis Mitte August beteiligte sich auch das 15. Lettische SS-Reserve- und Ergänzungsbrigadebataillon, das aus Ausbildungs- und Sanitätskompanien bestand, an der Verteidigung von Bauska gegen die zweite sowjetische Besetzung. Insgesamt kämpften 3.000 bis 4.000 lettische Soldaten um Bauska und sahen sich am Ende einer zehnfachen Übermacht gegenüber. Sowjetische Truppen konnten Bauska erst am 14. September nach anderthalb Monaten Widerstand lettischer und deutscher Soldaten einnehmen.
Gedenkensemble für diejenigen, die gegen die sowjetische Besatzung kämpften, und für die Opfer der kommunistischen Repression im Schlossgarten von Bauska
Die Gedenkstätte im Schlossgarten von Bauska wurde am 18. November 2008, dem 90. Jahrestag der Republik Lettland, eingeweiht. Sie entstand auf Anregung des politisch verfolgten Vereins „Rēta“ aus der Region Bauska. Das zweiteilige Denkmal aus grauem Granit wurde nach einem Entwurf der Architektin Inta Vanaga mit Mitteln der Stadt Bauska und von Spendern errichtet. Die Inschrift lautet: „Den Kämpfern gegen das sowjetische Besatzungsregime, den Verhafteten, Deportierten und Gefolterten 1940–1990“. Jedes Jahr am 25. März und 14. Juni finden hier Gedenkveranstaltungen für die Opfer der Deportationen von 1941 und 1949 statt.
Denkmal für die Verteidiger von Bauska gegen die sowjetische Besatzung im Jahr 1944 im Garten der Evangelisch-Lutherischen Heiliggeist-Kirche
Im Garten der Evangelisch-Lutherischen Heilig-Geist-Kirche in Bauska wurden die Verteidiger von Bauska – lettische Soldaten – während der Kämpfe von 1944 beigesetzt. Während der sowjetischen Besatzung befanden sich hier Spielplätze für einen Kindergarten. Am 9. November 1996 wurde im Kirchgarten ein Gedenkstein des Bildhauers Mārtiņš Zaurs enthüllt. Die Inschrift auf dem grob bearbeiteten roten Stein unter dem Ärmelabzeichen der Lettischen Legion – einer rot-weißen Darstellung des Schildes – lautet: „Es lebe Lettland! Den Verteidigern von Bauska im Jahr 1944.“ Der Gedenkstein wurde auf Initiative des Lettischen Nationalen Soldatenverbandes und der Bauskaer Ortsgruppe der Organisation „Daugavas Vanagi“ errichtet. Finanzielle Unterstützung kam von der Stadt und dem Landkreis Bauska. Neben dem Stein befindet sich ein weiß gestrichenes Holzkreuz, unter dem eine rot-weiß-rot bemalte Nachbildung des Legionärsschildes angebracht ist, und noch tiefer befindet sich eine rosa Granittafel mit der Inschrift: „Hier ruhen die Legionäre, die heldenhaften Verteidiger von Bauska, 28. Juli 1944 – 14. September 1944“.
Gedenktafel für die Opfer der Repressionen des sowjetischen Besatzungsregimes in Bauska, Plūdoņa-Straße 54
Haus und Gedenktafel für die Opfer der Tscheka-Repressionen am Gebäude in der Plūdoņa-Straße 54 in Bauska. Hier befand sich nach dem Zweiten Weltkrieg während der sowjetischen Besatzung der Bezirk Bauska, später der Bezirk Tscheka. Nationale Partisanen und ihre Unterstützer wurden hier in den Kellern inhaftiert und verhört, getötete Partisanen wurden zur Identifizierung und Einschüchterung der Anwohner in den Hof geworfen. Die Gedenktafel wurde nach 2000 enthüllt. Sie zeigt stilisierten Stacheldraht, Gefängnisgitter und den Text: „Die Sohlen der Stiefel klappern, hundert Menschen stöhnen … Jeder Tag ist eine Erinnerung, die das Herz nicht vergisst. Während der sowjetischen Besatzung beherbergte dieses Gebäude die Bezirksabteilung Bauska des Repressionsinstituts NKWD (Tscheka), wo Menschen ihrer Heimat, ihres Zuhauses, ihrer Familie, ihrer Freiheit und ihres Lebens beraubt wurden.“ Während der Besatzungszeit befand sich neben diesem Haus eine Gedenktafel für drei gefallene Vertreter der Besatzungsbehörden, die bei einem erfolglosen Versuch, einen nationalen Partisanen – Jānis Gudžas – zu besiegen, ihr Leben verloren.
Denkmal für lettische und litauische Nationalpartisanen auf dem Friedhof Plūdoņas, Pfarrei Ceraukste
Die Gedenkstätte für lettische und litauische nationale Partisanen wurde am 11. September 2011 eröffnet. Sie verfügt über ein weiß gestrichenes Metallkreuz, an dessen Fuß sich eine Granitstele mit den Namen von vierzehn nationalen Partisanen und dem Text befindet: „Für dich, Vaterland. Lettische und litauische nationale Partisanen. Gefallen im Kampf gegen die kommunistische Besatzung in den Gemeinden Ceraukste, Panemune, Īslīce und Pabirži.“ (Litauen) 1945–1954. Jānis Gudža, Teodors Auniņš, Pēteris Varens, Žanis Strautiņš, Miķelis Dombrovskis, Vilis Krūmiņš, Olģerts Trans, Laimonis Auniņš, Jānis Ulinskis, Jānis Anilonis, Povilas Glinda, Petras Gibrjūnas, Petras Volosklāvičius, Alberts „Voldmerārs“ „Direktor“. Eure Gräber sind unbekannt.“
Die Gedenkstätte wurde vom Lettischen Nationalen Partisanenverband mit Unterstützung der Regionalregierung von Bauska errichtet, und das Kreuz wurde von dem Feinmechaniker Harijs Frīdemans aus Dobele mit seinem eigenen Geld angefertigt.
Denkmal für lettische und litauische Nationalpartisanen im Schulpark Mežgaļi, Pfarrei Brunava
Die Gedenkstätte für lettische und litauische Nationalpartisanen wurde am 25. Mai 2007 eröffnet. Sie besteht aus einem weiß gestrichenen Kreuz, an dessen Fuß eine Granitstele mit den Namen von zehn Nationalpartisanen und der Inschrift „Für Dich, Vaterland! Den Nationalpartisanen von Panėmūne. Denjenigen, die im Kampf gegen das kommunistische Besatzungsregime von 1944 bis 1952 gefallen sind. Jānis Dručka, Andrejs Bojasts, Arvīds Melducis, Augusts Juškēvičs, Willi Fischer, Stanislovas Naudžius – „Mykolas“, Juozas Krikščiūnas – „Karlis“, Juozas Balčiūnas – „Klemute“, Augustas Pareizis – „Kazys“, „Juozupas“, Jonas Sirbike – „Janis““ steht. Die Gedenkstätte wurde vom Lettischen Nationalen Partisanenverband nach dem Entwurf des Architekten Gunārs Blūzma gestaltet.
Denkmal für die Kapuzinermönche – Unterstützer der nationalen Widerstandsbewegung – in der Nähe der Kirche von Skaistkalne
Das Denkmal befindet sich in der Nähe der katholischen Kirche von Skaistkalne und des ehemaligen Klostergebäudes des Kapuzinerordens – einem Ort, an dem sich nach dem Zweiten Weltkrieg mit Unterstützung der Mönche nationale Partisanen und ihre Anhänger versteckten. Auf der 2011 enthüllten und von Paulinerpater Jānis Vīlaks geweihten Gedenkstele heißt es: „Mönche des Kapuzinerordens – Anhänger der nationalen Widerstandsbewegung Kārlis Gumpenbergs OMC (1904-1980), Miķelis Jermacāns OMC (1911-1986), Kārlis Kiselevskis OMC (1906-1979), Miķelis Kļaviņš OMC (1906-1986), Jānis Pavlovskis OMC (1914-2001) Sie boten 1945-1947 nationalen Partisanen und illegal aufhältigen Personen in Riga, Skaistkalne und Viļaka Unterkunft und Unterstützung.“
Die Einweihung des Gedenksteins für die Kapuzinerpatres fand am 8. Oktober 2011 statt. Der Stein wurde von Pater Jānis Vīlaks, dem Paulinerpater der katholischen Kirche von Skaistkalne, geweiht. An der Zeremonie nahmen der Vorsitzende des Lettischen Nationalen Partisanenverbandes, Ojārs Stefans, die Leiterin der Pfarrverwaltung von Skaistkalne, Ineta Skustā, und weitere Anwohner teil.
Denkmal für nationale Partisanen in der Gemeinde Kurmene
Die Gedenkstätte für die nationalen Partisanen in der Nähe des Gemeindehauses von Kurmene wurde am 4. Mai 2023 an der Stelle eines Denkmals eröffnet, das die Besatzungstruppen der UdSSR verherrlichte. Dieses Denkmal war gemäß dem Gesetz „Über das Verbot der Ausstellung von Objekten, die das sowjetische und nationalsozialistische Regime verherrlichen, und deren Entfernung auf dem Gebiet der Republik Lettland“ abgebaut worden, das die Saeima der Republik Lettland im Juni 2022 verabschiedet hatte. Auf der Gedenkstätte wurde ein weiß gestrichenes Holzkreuz aufgestellt, zu dessen Fuß eine schwarze Granitstele mit der Inschrift steht: „Den nationalen Partisanen von Kurmene und den umliegenden Gemeinden 1944–1953. Sie werden uns brechen, aber sie werden uns nicht beugen.“
Rechts neben dem Gedenkschild befindet sich ein Informationsstand über die kurmenischen Nationalpartisanen, der vom Historiker des Museums Bauska, Raits Ābelnieks, zusammengestellt wurde. Die Gedenkstätte entstand auf Initiative von Anwohnern und mit Unterstützung des Kurmener Ortsverbands des Seniorenverbands der Region Bauska sowie des Regionalrats Bauska.
Im Osten der Region Bauska – in den Kirchspielen Skaistkalne, Kurmene, Bārbele und Valle – fand ein aktiver Widerstand gegen das sowjetische Besatzungsregime und die Repressionen der Behörden statt. In diesem Gebiet hielten sich seit der zweiten sowjetischen Besetzung im Herbst 1944 viele Männer vor den Behörden versteckt. Die Mežabrāļi waren bereit, sich den Festnahmeversuchen der Behörden zu widersetzen, weshalb sie mit Waffen und Munition versorgt wurden. Dies war damals problemlos möglich, da es auf den ehemaligen Schlachtfeldern keinen Mangel an solchen Gütern gab.
Es wurden Kontakte zwischen einzelnen Gruppen geknüpft und größere Partisaneneinheiten gebildet. Ihnen schlossen sich ehemalige Soldaten der Lettischen Legion aus Kurzeme an, die nach der deutschen Kapitulation nicht die Waffen niedergelegt und kapituliert hatten, sondern den Kampf gegen die Besatzer fortsetzten. Zwischen Juli und September wurde eine nationale Partisaneneinheit von etwa 20 Mann aufgestellt, deren Kern aus Einwohnern der Gemeinde Kurmene bestand. Ihr gehörten auch Männer und Jugendliche aus Bārbele, Skaistkalne, Valle und der benachbarten Gemeinde Mazzalve im Bezirk Jēkabpils an.
Ludvigs Putnieks, geboren 1912, aus der Kurmene-Gemeinde „Nagliņiem“, wurde Kommandeur der Einheit, sein Stellvertreter war der ehemalige Legionär Viktors Ančevs aus der gleichen Gemeinde „Mūrniekim“. In den 1930er Jahren leitete L. Putnieks den Kurmene-Zweig der patriotischen Jugendorganisation „Latvijas Vanagi“.
Diese Partisaneneinheit verübte im Herbst und Winter 1945 mehrere Angriffe auf Beamte der Besatzungsbehörden und überfiel Kollaborateure sowie staatliche Molkereien und Geschäfte. Dies geschah, um die Versorgung der „Waldbrüder“ für deren ohnehin schon fast bankrotte Angehörige und andere Unterstützer nicht zu einer schweren Belastung werden zu lassen. Mehrere Kämpfer der Zerstörerbataillone, die sogenannten „Istrebikes“, sowie die von den Besatzungsbehörden eingesetzten Mitglieder des Partisanen-Dorfrats von Kurmene und des Gemeindevorstands von Skaistkalne fielen Partisanenkugeln zum Opfer. Diese Partisanenaktivitäten schwächten die Bereitschaft der Kollaborateure, die Befehle der Besatzungsbehörden auszuführen, erheblich.
Wie die nachfolgenden Ereignisse belegten, war es jedoch gelungen, einen Agenten in L. Putnieks' Partisanengruppe eingeschleust zu haben. Am 14. Januar 1946, als V. Ančevs seine Mutter in „Mūrnieki“ besuchte, trafen Milizionäre und Mitglieder der „Istrebiķe“ ein, um ihn festzunehmen. Es kam zu einem Schusswechsel, bei dem der Waldbruder und seine Mutter in einem ungleichen Kampf ums Leben kamen.
Am 2. Februar griffen Einheiten des 288. Schützenregiments der Inneren Truppen der UdSSR Partisanenbunker im Wald der Gemeinde Mazzalve nahe der Grenze zur Gemeinde Kurmene an. In einem blutigen Kampf gegen die zahlenmäßig weit überlegenen Partisanen fielen Jānis Teodors Meija aus der Gemeinde Valle, Vilips Saulītis aus der Gemeinde Skaistkalne, Arnolds Freimanis aus der Gemeinde Kurmene, Fricis Galviņš aus der Gemeinde Mazzalve sowie ein unbekannter Einwohner Rigas mit dem Spitznamen Ika oder Jonelis. Den anderen Waldbrüdern gelang der Rückzug, und sie verschwanden im Getümmel des Gefechts. Über die Verluste der Angreifer liegen keine Informationen vor. Bei nachfolgenden Operationen der Tschekisten wurden mehrere weitere Partisanen getötet oder gefangen genommen.
Der Grabstein des Nationalpartei-Anhängers Edmunds Vigmanis, der 1941 fiel, auf dem Valle-Friedhof
Der Grabstein auf dem Friedhof von Valle wurde am 4. Juli 1941 für den Partisanen Edmunds Vigmanis errichtet, der hier am 30. Juli 1941 beigesetzt wurde und am 30. Juni in einem Gefecht mit sowjetischen Verbänden gefallen war. Die Gedenktafel zeigt eine Keramikmedaille mit einem Foto von E. Vigmanis in Gardeuniform und folgender Inschrift: „Vigmanis Edmunds. Geboren am 6. April 1907. Gefallen in Partisanenkämpfen in Valle am 30. Juni 1941. Die Landsleute, die an mir vorbeigehen, brennen vor Liebe zum Vaterland. Dem geliebten Vaterland schwöre ich mein Leben.“
Nach Beginn des deutsch-sowjetischen Krieges und der Flucht der Angestellten des Gemeindevorstands von Taurkalne versammelten sich am 30. Juni Einwohner im Gemeindesaal von Taurkalne in Valle, hissten die lettische Flagge und bildeten eine 25-köpfige nationale Partisaneneinheit unter der Führung des Wachmanns Osvalds Ivanovskis. Die Einheit war jedoch nur teilweise mit Gewehren und Schrotflinten bewaffnet. Am selben Tag kam es bei Jaunbruntālie zu einem Gefecht mit etwa zwanzig Rotarmisten. Dabei wurden weitere Waffen erbeutet, fünf Soldaten getötet, acht verwundet und die restlichen Rotarmisten zerstreut. Der nationale Partisan und Besitzer von Jaunbuki, Edmunds Vigmanis, fiel im Kampf, während O. Ivanovskis und der Besitzer von Bārzdiņi, Jānis Krūmiņš, verwundet wurden.
Das Gebäude der Landwirtschaftsakademie in Jelgava in der Lielāja-Straße 2, in dem Mitglieder des Lettischen Zentralrats in den Jahren 1943-1944 arbeiteten.
Mehrere Mitglieder der akademischen Einheit „Austrums“ und des Zentralrats von Lettland, die am 13. August 1943 heimlich in Riga gegründet worden waren, arbeiteten 1943/44 an der Landwirtschaftlichen Akademie in Jelgava (Mītava) (heute Lettische Universität für Biowissenschaften und Technologien) – darunter die Professoren Rūdolfs Markuss, Andrejs Teikmanis und Alfrēds Tauriņš sowie weitere Lehrkräfte. Am 10. März 1944 druckte Vilis Eihe, ein Assistenzprofessor der Landwirtschaftlichen Akademie, zusammen mit seiner Frau Aleksandrs und seinem Assistenten Hermanis Zeltiņš in Jelgava mit einem Vervielfältigungsgerät die illegale Zeitung der LCP, „Jaunā Latvija“. Sie berichtete über die internationale Lage Lettlands und legte weitere Leitlinien für das politische Leben Lettlands fest. Unter den 188 lettischen sozialpolitischen Aktivisten, die in dem Memorandum der LCP vom 17. März 1944 die Notwendigkeit der Wiederherstellung einer unabhängigen und demokratischen Republik Lettland auf der Grundlage der Verfassung von 1922 zum Ausdruck brachten, befanden sich die akademischen Mitarbeiter der Landwirtschaftsakademie in Jelgava – die Professoren Jānis Vārsbergs, Pāvils Kvelde, A. Teikmanis und R. Markuss.
Gedenktafel für die Teilnehmer des schulischen Jugendwiderstands an der Grundschule der Stadt Bauska in der Rigasstraße 32
Eine Gedenktafel für die Mitglieder der Jugendwiderstandsorganisation an der Grundschule der Stadt Bauska in der Rīgas-Straße 32, wo sich nach dem Zweiten Weltkrieg das Gymnasium Bauska befand. Die Inschrift auf der im Jahr 2000 enthüllten Tafel lautet: „… Und wir trugen nur unsere Herzen hoch. Eine Gruppe junger Nationalwiderstandskämpfer lernte in dieser Schule und widmete ihre Jugend dem Kampf gegen die kommunistische Besatzungsmacht (1948–1950).“
Im Herbst 1948 formierte sich in Bauska eine nationale Widerstandsgruppe patriotischer Jugendlicher. In ihren in der Stadt ausgehängten Proklamationen und Parolen riefen sie zum Kampf gegen die Besatzer und zur Wiederherstellung der lettischen Unabhängigkeit auf und warnten vor den vom kommunistischen Regime für den 25. März 1949 angekündigten Deportationen. Einige Jugendliche aus Bauska studierten nach ihrem Schulabschluss in Riga, engagierten sich aber weiterhin in dieser Untergrundorganisation. Einige von ihnen hatten Waffen und Sprengstoff beschafft und ein Attentat auf den Vorsitzenden der Kolchose in der Gemeinde Codes verübt. Geplant waren außerdem Angriffe auf weitere Funktionäre der sowjetischen Besatzungsbehörden sowie die Sprengung der Feststände in Bauska, Baldone und Eleya. Dazu kam es jedoch nicht, da Mitte 1950 Verhaftungen begannen. In Bauska und Riga wurden zwölf Jugendliche verhaftet, einige von ihnen am Tag ihres Schulabschlusses – dem 22. Juni. Im Februar 1951 verurteilte das Baltische Kriegsbezirkstribunal die Anführer der Organisation, Gunārs Zemtautis und Arvīds Klēugas, zum Tode und sechs Gymnasiasten sowie vier Studenten zu 25 Jahren Zwangsarbeit in Lagern.
Ģ. Elias Museum für Geschichte und Kunst Jelgava
Das Ģ. Elias Museum für Geschichte und Kunst in Jelgava befindet sich im Gebäude der Academia Petrina (Peters-Akademie). Diese wurde 1775 als erste Universität Lettlands gegründet und zählt zu den wenigen öffentlichen Gebäuden der Stadt, die den Zweiten Weltkrieg überstanden haben und restauriert wurden.
Im Sommer 1944 verlor Jelgava nahezu alles – einen Großteil seiner Bevölkerung sowie zahlreiche historische Gebäude, von denen nur wenige nach dem Krieg wiederhergestellt wurden. Der Vorläufer des heutigen Museums, das Kurländische Provinzmuseum, wurde 1818 gegründet. Es war das zweitälteste Museum Lettlands und das erste außerhalb Rigas. Seit 1952 ist das Museum in der Academia Petrina untergebracht.
Heute zeigt es Dauerausstellungen über den bedeutenden lettischen Künstler Ģederts Elias (1887–1975), die Vorgeschichte sowie das Mittelalter in Semgallen, Jelgava zur Zeit des Herzogtums Kurland und Semgallen (1561–1795), während des Gouvernements Kurland (1795–1918) und in der ABSCHNITTe des unabhängigen Lettlands (1918–1940).
Die Ausstellung „Das Leben geht unter fremden Mächten weiter“ zeigt das Leben in Lettland während der deutschen und sowjetischen Besatzung.
Die virtuelle Ausstellung „ Kriege und ein Soldat im Laufe der Zeit in Jelgava“ gibt Einblicke in die kriegerischen Ereignisse, die die Stadt geprägt haben – darunter auch der Erste und der Zweite Weltkrieg.
Denkmal für die Befreier von Jelgava „Lāčplēsis“
Das Denkmal für die Befreier von Jelgava „Lāčplēsis“ befindet sich in Jelgava, im Stacijas-Park, gegenüber dem Bahnhof. Es wurde am 22. Juni 1932 in Anwesenheit des lettischen Präsidenten A. Kviesis eröffnet und zum Gedenken an die Befreiung von Jelgava am 21. November 1919 während des lettischen Unabhängigkeitskrieges errichtet. Im Jahr 1940, während der ersten sowjetischen Besatzungszeit, blieb das Denkmal unverändert. Als 1941 die sowjetischen Besatzer durch die deutsche Besatzungsmacht abgelöst wurden, gefiel dem Leiter der deutschen Besatzungsverwaltung, von Medem, der nach Jelgava zurückgekehrt war (seine Vorfahren waren die ursprünglichen Erbauer der Burg Jelgava), die unmissverständliche Symbolik des Denkmals nicht. Am 31. Oktober 1942 wiesen die deutschen Besatzungsbehörden den Autor des Denkmals, Kārlis Jansons, an, ein Bildnis eines deutschen Ritters zu schaffen.
Im Jahr 1950 ordnete die sowjetische Besatzungsmacht die Zerstörung des Denkmals an. Mit Hilfe eines Traktors wurde Lāčplēsis von seinem Sockel gestoßen, zertrümmert und es wurde versucht, es in einem Steinbrecher vollständig zu zerstören. Lāčplēsis erwies sich jedoch als so hart, dass der Steinbrecher zerbrach. Der unversehrte mittlere Teil des Denkmals wurde heimlich auf dem Gelände des Kindergartens in der Erde vergraben.
Im Jahr 1988 wurde ein Fragment des Denkmals gefunden, das sich heute vor dem G. Eliass-Museum für Geschichte und Kunst Jelgava befindet. Das Denkmal wurde restauriert und am 21. November 1992 eingeweiht. Der Autor ist der Bildhauer Andrejs Jansons, der das von seinem Vater Kārlis Jansons geschaffene Denkmal wiederhergestellt hat.
Der Turm der St. Dreifaltigkeitskirche in Jelgava
Der Turm der St. Dreifaltigkeitskirche in Jelgava befindet sich im Zentrum von Jelgava.
Die Geschichte des Turms erstreckt sich über mehr als vier Jahrhunderte und ist ein wichtiger Zeuge sowohl der Entwicklung der Stadt als auch tragischer Ereignisse. Die Kirche wurde 1574 im Auftrag des Herzogs von Kurland und Semgallen, Gotthard Kettler, erbaut und ihr Turm, der 1688 unter der Leitung des Meisters Martin Knoch fertiggestellt wurde, wurde zu einem der bedeutendsten Bauwerke der Stadt. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Jelgava stark zerstört und die Kirche brannte 1944 nach einem sowjetischen Luftangriff nieder. Nach dem Krieg sprengten die sowjetischen Behörden den Altar und zerstörten die Mauern. Nur der Turm blieb als strategisches Objekt erhalten, da er der höchste Punkt der Stadt war. Während und nach dem Krieg wurde der Turm für militärische Zwecke genutzt. Vom Turm aus wurden die feindlichen Stellungen beobachtet und das Gebiet kontrolliert.
In den Nachkriegsjahren diente der Turm auch als strategischer Punkt für Widerstandsaktivitäten. Er wurde zu einem geheimen Treffpunkt und einer Basis für die Übergabe von Informationen, die für den Kampf gegen das sowjetische Regime unerlässlich waren. Der Turm hat zwar seine historische Bedeutung behalten, ist aber heute als Kultur- und Bildungszentrum wiedererstanden.
Zukünftiger Park
Südlich des Dorfes Nākotne gelegen, beherbergt der Nākotne-Park die sowjetische Antonow An-2. Sie war primär als ziviles Mehrzweckflugzeug konzipiert, wurde aber auch militärisch eingesetzt. Ihr Erstflug fand 1947 statt. Dank ihrer hervorragenden Kurzstart- und Landeeigenschaften war sie ein sehr vielseitiges Flugzeug und eignete sich daher für eine Vielzahl von Aufgaben, darunter auch militärische.
Die militärische Nutzung des Flugzeugs umfasste:
- Transport von Truppen und Soldaten an schwer zugängliche Orte;
- Fallschirmspringerausbildung und -transport;
- Bereitstellung von Logistik und Versorgungsgütern, wie z. B. die Lieferung von Lebensmitteln, Munition und medizinischer Ausrüstung in Kampfgebiete;
- Aufrechterhaltung der Kommunikation zwischen verschiedenen militärischen Einheiten;
- Patrouillenflüge und Aufklärung.
Dank ihrer einfachen Konstruktion und Zuverlässigkeit eignete sich die AN-2 für Einsätze unter Feldbedingungen, die keine gut ausgebaute Infrastruktur erforderten. Ihre Reichweite und die Fähigkeit, in niedrigen Höhen zu fliegen, machten sie in unterschiedlichsten Klimazonen, einschließlich Konflikten mit Beteiligung der Sowjetunion oder ihrer Verbündeten, sehr nützlich.
Das Flugzeug wurde in vielen Ländern eingesetzt, darunter Osteuropa und Asien, wo es sowohl zivilen als auch militärischen Streitkräften diente.
Technische Daten des AN-2:
- Technische Daten des AN-2:
- Besatzung: 2
- Passagierkapazität: bis zu 12
- Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h
- Reisegeschwindigkeit: 180 km/h
- Maximales Startgewicht: 5250 kg
- Maximale Flugdistanz: 1200 km
- Maximale Flugdauer: 7 Stunden
- Kraftstoffkapazität: 1200 l
- Tragfähigkeit: 1500 kg
- Länge: 12,4 m
- Spannweite: 18,2 m
- Höhe: 4,1 m
Der zukünftige Park präsentiert auch den GAZ-63, einen leichten Lkw mit Allradantrieb, der von 1948 bis 1968 produziert wurde. Er war für zuverlässige Transporte unter schwierigen Bedingungen auf und abseits befestigter Straßen konzipiert. Der GAZ-63 war eines der ersten sowjetischen Fahrzeuge mit permanentem Allradantrieb. Diese Konstruktion ermöglichte hervorragende Fahrleistungen in Schlamm, Schnee und anderen schwierigen Gebieten, was für militärische und zivile Zwecke unerlässlich war. Das Fahrzeug wurde in Gorki (heute Nischni Nowgorod) produziert, einem der wichtigsten Zentren der Automobilindustrie in der Sowjetunion. Der GAZ-63 war mit einem Sechszylinder-Benzinmotor mit rund 70 PS ausgestattet. Dieser Motor war für seine Zeit sparsam und unter verschiedenen Betriebsbedingungen zuverlässig. Der GAZ-63 wurde sowohl in der sowjetischen Armee als auch im zivilen Bereich – in der Forstwirtschaft, Landwirtschaft und im Straßenbau – weit verbreitet eingesetzt. Seine einfache Konstruktion ermöglichte schnelle Reparaturen und Wartungsarbeiten, selbst in abgelegenen Gebieten.
Ein in der Sowjetunion hergestellter Segelflieger ist ausgestellt.
Im Park der Zukunft befindet sich auch das Antiquitätenlager und die Werkstatt „Zeitmaschine“, in der verschiedene Artefakte besichtigt werden können, darunter ein spezieller Pilotenanzug für Flüge mit Überlastung sowie andere Gegenstände aus der Sowjetzeit.
Am Ende der Tour können Sie bei „Nordcrunch“ die im „Park der Zukunft“ hergestellten Produkte verkosten.
Kommunikationsbunker
Der Kommunikationsbunker Vecmīlgrāvis in Riga ist ein historisches Bauwerk aus der Sowjetzeit. Er diente ursprünglich als Reserve-Kontrollpunkt des damaligen Bezirks Oktyabr und gleichzeitig als Zivilschutzzentrale der Rigaer Schiffswerft. Er wurde errichtet, um die Einsatzleitung im nördlichen Bezirk in Notfällen wie einem Atomkrieg oder einer Naturkatastrophe sicherzustellen.
Der Bunker verfügte über alles Notwendige für einen autonomen Betrieb: Kommunikationsknotenpunkte zur Verbindung mit anderen wichtigen Objekten, eine unabhängige Strom- und Wasserversorgung sowie Räumlichkeiten zum Schutz der Personen. Nach dem Ende der Sowjetzeit verfiel der Bunker und wurde geplündert, doch in den letzten Jahren wurde er von lokalen Enthusiasten sorgfältig restauriert und in das Zivilschutzmuseum „Kommunikationsbunker“ umgewandelt.
Die Ausstellung des Museums präsentiert authentische Arbeitsbereiche, Kommunikationsgeräte, Schutzausrüstung, historische Dokumente und Karten und ermöglicht es den Besuchern, das Zivilschutzsystem des Kalten Krieges zu erkunden und die Atmosphäre jener Zeit zu spüren. Es ist eine einzigartige Zeitreise, die sowohl Geschichtsbegeisterte als auch alle, die etwas Außergewöhnliches suchen, fesseln wird.
Das Museum bietet regelmäßig Führungen an, bei denen Besucher die Geschichte und Bedeutung des Bunkers kennenlernen können. Für einen Besuch empfiehlt es sich, sich vorab für eine Führung anzumelden oder die offiziellen Social-Media-Kanäle des Museums zu den anstehenden Veranstaltungen zu verfolgen.
Gedenkstätte in Kambari
Die Gedenkstätte in Kambari liegt etwas versteckt. Wenn Sie auf der Autobahn Riga-Liepāja zwischen Annenieki und Kaķenieki fahren, biegen Sie links auf einen Feldweg ab und fahren etwa 2 Kilometer.
Die Schlachten von Kambari und Ileni sind mit ihren unzähligen Gefallenen auf beiden Seiten in die Geschichte eingegangen. Das Denkmal wurde auf dem Gelände des ehemaligen Gehöfts Kambari errichtet, wo im Januar 1945 eine der sinnlosesten Schlachten stattfand, in der mindestens 3.000 Soldaten fielen.
Die Frontlinie der Kurischen Festung rückte im Winter 1944/45 durch Annenieki vor. Hier kämpfte das 319. Regiment der 308. Lettischen Schützendivision der Roten Armee gegen Einheiten der 19. Division der Lettischen SS-Freiwilligenlegion. Hier kämpften Letten gegen Letten.
Der Fotograf, Publizist und Schriftsteller Gunārs Birkmanis hielt die Erinnerungen seines Schulkameraden Alfons Kalniņš in seinem Buch „Reflexionen eines Jahrhunderts“ fest: 1946 fuhren wir zu den Feldern von Īleni und Kambari, um nach Waffen zu suchen. Dort erstreckten sich zwei große Felder voller Überreste gefallener Rotarmisten. Tausend, glaube ich, oder mehr Skelette in grauen russischen Armeemänteln. Sie besaßen nichts: keine Waffen, keine Habseligkeiten, keine Dokumente, die ihre Zugehörigkeit belegten. Wir wussten, dass es sich um Letten handelte, die von den Russen mobilisiert worden waren.
Während der Sowjetzeit wurde an diesem Ort ein Denkmal errichtet, das die dortigen Ereignisse im sowjetischen Geiste interpretiert. Das Monument – die Figuren eines stehenden Mädchens und eines jungen Mannes – stammt von einem der vielen nahegelegenen Brüderfriedhöfe, wo Soldaten umgebettet wurden. Die alte Inschrift in Lettisch und Russisch ist noch immer auf der Gedenktafel zu lesen: „Hier fanden die Schlachten des 12. und 12. Juli 1944 um die Befreiung der Region von den deutschen Besatzern statt.“ Ein kleiner Gedenkstein mit der Aufschrift „Vermisster Soldat 1944–1945“ wurde kürzlich in der Nähe aufgestellt.
Mangalsala Straße
Ende des 19. Jahrhunderts begann man in Mangaļsala mit dem Bau von Befestigungsanlagen. Im Zuge dessen entstand auch diese gepflasterte Straße, da der trockene, feine Sand von Mangaļsala für schwere Lastwagen praktisch unpassierbar war. Früher führte die Straße vom Vecdaugava-Staudamm (dem Eingang nach Mangaļsala von der Vecāķi-Seite) bis zum Armeehafen am Ufer der Düna. Leider wurde ein Großteil der Straße im Laufe der Zeit von skrupellosen Personen in Besitz genommen, sodass sie abschnittsweise nicht mehr für Pkw befahrbar ist. Ein Teil der Straße war einst asphaltiert.
Eisenbahnstrecke und Bahnsteig
Um 1958 wurde für die Bedürfnisse der sowjetischen Armee eine spezielle Bahnstrecke von Vecāķi nach Mangaļsala gebaut. Sie war der bequemste Weg, Treibstoff, Munition, Waffen und Baumaterialien zum dortigen Militärstützpunkt zu transportieren. Bereits zuvor, ab dem 20. Jahrhundert bis in die Sowjetzeit, verlief eine Schmalspurbahn durch ganz Mangaļsala und transportierte Munition zu den Geschützstellungen. Später wurde eine größere Bahnstrecke errichtet, die die Vecdaugava über einen der beiden – weniger bekannten – Dämme auf Mangaļsala überquerte. Dieser Damm ist beispielsweise von Vecāķi aus nicht mehr zugänglich, da die Sicht durch Privatgrundstücke versperrt ist. Der sichtbare Betonhügel diente als Bahnsteig. Als die sowjetischen Truppen Anfang der 1990er-Jahre Lettland verließen, wurden 600 Waggons mit etwa 30 Tonnen Munition über diese Bahnstrecke transportiert. Man sagt, die Arbeiten seien damals so überhastet und nachlässig ausgeführt worden, dass „ganz Riga aus der Luft zu sehen gewesen wäre“. Oder zumindest ein bestimmter Stadtteil von Riga. Kurz darauf wurde die Bahnstrecke wieder abgebaut.
Geschlossene Munitionsdepots aus den 1950er Jahren
In den 1950er Jahren wurde ein solcher Bunker errichtet und mit Erde bedeckt, um ihn für einen potenziellen Feind schwerer auffindbar zu machen. Insgesamt gibt es in Mangalsala vier solcher Gebäude, die alle zwischen 1953 und 1955 erbaut wurden. Zu Sowjetzeiten wurde hier Munition gelagert – Unterwasserminen, Torpedos usw. Heute ist dies das am besten erhaltene der geschlossenen Munitionsdepots aus der Sowjetzeit; etwas weiter entfernt befindet sich das größte.
Achtung! Zum Schutz der überwinternden Fledermäuse (alle Arten stehen unter Schutz) dürfen Sie sich von Oktober bis April nicht in unterirdischen Gebäuden oder Bunkern aufhalten.
Offene Munitionsdepots, Blitzableiter, Brunnen
Während der Sowjetzeit wurde so viel Munition und militärische Ausrüstung nach Mangaļsala gebracht, dass die Lagerhallen nicht ausreichten. Daher musste ein Großteil davon im Freien gelagert werden. Nur feuchtigkeitsempfindliche Güter wurden in den Lagerhallen untergebracht. Diese Vorgehensweise verdeutlicht die nachlässige Haltung der Sowjetarmee gegenüber jeglichem Lagerbestand: Um das Lager wurde ein Sandwall aufgeschüttet, von dem heute noch ein kleiner Hügel erhalten ist. Der Wall selbst schützte die Munition vor Feuer und Explosionen. Sollte in der Nähe eine Rakete explodieren, würde die Druckwelle auf den Wall treffen und sich nicht oder nur in geringem Umfang ausbreiten. In der Nähe befindet sich ein Stahlbetonmast – ein Blitzableiter! Solche Masten schützten die Munition vor Blitzeinschlägen. Ähnliche Masten sind auch an anderen Stellen zu sehen. Ehemalige Brunnen sind ebenfalls erkennbar, die im Notfall zum Löschen von Wasser dienten. Informationen über die Munitionsdepots in Mangaļsala waren generell streng geheim – selbst auf alten sowjetischen Militärkarten sind diese Orte als Pionierlager verzeichnet. Etwa 50 Meter hinter dem Damm befindet sich ein weiterer Betonbunker.
Projektillager
Dieses Gebäude wurde zwischen 1876 und 1885 unter Zar Alexander II. und später Zar Alexander III. errichtet. Besonders bemerkenswert ist die Fassade mit ihren Gesimsen, Fensteröffnungen und anderen dekorativen Elementen. Das Gebäude diente als Lager für Kanonengranaten. Etwa 300 Meter entfernt befindet sich ein weiteres Lager dieser Art, das sogar über schöne, geschwungene Fenstergitter verfügt. Ähnliche Militärgebäude aus rotem Backstein finden sich noch heute vereinzelt in Lettland – beispielsweise in Liepāja Karosta. Alle Backsteingebäude auf dem Gebiet von Mangaļsala wurden etwa zur gleichen Zeit errichtet. Damals war die politische Lage in Europa angespannt, und das Russische Reich begann, seine Westgrenze militärisch zu verstärken. Das Gebäude besitzt eine doppelte Außenwand, zwischen der Luft zirkuliert. Dies sorgt nicht nur für zusätzliche Belüftung und gewährleistet die notwendige Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Gebäude, sondern bietet auch Schutz vor Explosionen. Im Falle einer großen Explosion stürzt die Außenmauer ein, die Innenmauer bleibt jedoch intakt und schützt so das Gebäudeinnere. Auf den Bunkern gegenüber der Mangaļsalas-Straße befanden sich Mörserstellungen. Während der Zeit des freien Lettlands – im Jahr 1926 – wurden die Mörser durch Flugabwehrkanonen ersetzt. Nicht weit von hier steht eine der dicksten Kiefern Rigas. Sie ist nicht nur dick und groß, sondern auch gezeichnet – Einschusslöcher finden sich am Stamm. In welchen Schlachten die Kiefer verwickelt war, ist unbekannt.
Achtung! Zum Schutz der überwinternden Fledermäuse (alle Arten stehen unter Schutz) dürfen Sie sich von Oktober bis April nicht in unterirdischen Gebäuden oder Bunkern aufhalten.
Chemikalienlager und Umgehungsstraße
Dieser Bunker wurde 1955 während der sowjetischen Besatzung erbaut. Der Weg um das Gebäude war einst eine Umgehungsstraße, umgeben von einem doppelten Stacheldrahtzaun. Wachen patrouillierten dahinter und hielten Ausschau nach Unbefugten. In manchen Quellen wird das Gebäude als Munitionsdepot, in anderen als Chemikalienlager erwähnt. Angeblich befanden sich hier sogar Atomraketen, doch wurden keine Spuren von Strahlung gefunden. Im Inneren herrscht absolute Dunkelheit, doch man kann Licht erkennen. Es war einst ein Belüftungssystem. Dies ist das einzige Gebäude in Mangalsala mit einer solchen Anlage. Güter wurden mit Waggons entlang der Eisenbahnlinie hierher transportiert. Die Akustik ist hervorragend – einst probte hier sogar ein Jugendchor! Vereinzelt finden sich jedoch Graffiti an den Wänden.
Achtung! Zum Schutz der überwinternden Fledermäuse (alle Arten stehen unter Schutz) dürfen Sie sich von Oktober bis April nicht in unterirdischen Gebäuden oder Bunkern aufhalten.
Lettischer Armee-Schauplatz
Das eigentümliche, hufeisenförmige Betonbauwerk diente einst als Standort eines Suchscheinwerfers. Hundert Meter weiter in Richtung Vecāķi saß ein Suchscheinwerferbediener in einem kleinen Betonbunker und hielt Ausschau nach unbefugten Personen, die sich von der Küste her näherten. Da es hier praktisch keine Bäume gab, war das gesamte Gebiet gut einsehbar. Sollte ein Angreifer das Feuer auf die Lichtquelle eröffnen, wäre der Bediener – geschützt durch Dunkelheit und Beton – vollkommen sicher gewesen. Dieser Suchscheinwerfer wurde 1928 von der lettischen Armee errichtet, um das bereits militarisierte Mangaļsala weiter an ihre Bedürfnisse anzupassen. Später, während der sowjetischen Besatzung, konnte der Suchscheinwerfer auch dazu genutzt werden, Personen aufzuspüren, die in die entgegengesetzte Richtung in den „Wilden Westen“ fliehen wollten. Die Ausreise ohne Genehmigung war verboten. Neben der Sicherung wurde der Küstensand auch umgepflügt, um die Spuren illegaler Einwanderer oder Fußgänger sichtbar zu machen.
Küstenartilleriebatterie
Dies ist das größte militärische Bauwerk auf Mangalsala, dessen Bau zwischen 1912 und 1916 begann. Die Bunkerwände waren mehrere Meter dick, und eine Sandbank schützte ihn vor dem Meer. Während des Ersten Weltkriegs erreichte die deutsche Flotte Riga nur dank der hier stationierten Geschütze nicht. 1917 zogen sich die Russen eigenständig aus Riga zurück und sprengten dabei einen Teil des Bunkers. Während der lettischen Unabhängigkeitsbewegung in den 1930er Jahren und später in der Sowjetzeit wurde die Batterie renoviert und erweitert – die Geschützplattformen wurden erneuert und neue Geschütze installiert. 1941, im Zweiten Weltkrieg, sprengten die Russen die Batterie erneut, aus Furcht vor einem Einmarsch deutscher Truppen in Lettland. Die ersten Geschütze hatten eine Reichweite von etwa 12 bis 15 Kilometern, die neueren konnten Ziele in bis zu 40 Kilometern Entfernung treffen. Eine Inschrift trägt die Aufschrift: „Von Seeleuten erbaut“ – erbaut von Seeleuten im Jahr 1946. Im Keller des Bunkers befanden sich Munitionskeller, in denen die für die Geschütze benötigten Granaten gelagert wurden. Spezielle Luken in den Wänden ermöglichten das Nachladen der Geschütze im Gefecht. Heute befindet sich hier der längste Militärtunnel von Mangalsala – ein etwa 100 Meter langer Korridor. Im Frühjahr kommt es vor, dass Teile des Bunkers überflutet werden! In den 1960er Jahren entwickelte sich die Luftfahrttechnik rasant, Raketen und Luftverteidigungssysteme wurden erfunden, und diese Batterie mit all ihren Geschützen – einst so furchteinflößend und mächtig – wurde überflüssig.
Achtung! Zum Schutz der überwinternden Fledermäuse (alle Arten stehen unter Schutz) dürfen Sie sich von Oktober bis April nicht in unterirdischen Gebäuden oder Bunkern aufhalten.
Befestigungsanlagen an der Mündung des Flusses Daugava
Die Befestigungsanlagen an der Mündung der Düna sind die ältesten Bauwerke auf Mangaļsala. Hier lässt sich die gesamte 400-jährige Geschichte des militärischen Erbes der Insel sowie Beispiele militärischer Architektur aus verschiedenen Epochen – der schwedischen, der zaristischen, der Zeit des unabhängigen Lettlands und des Zweiten Weltkriegs – nachvollziehen. Die ersten Geschützstellungen in diesem Gebiet tauchen bereits im 17. Jahrhundert mit dem Bau der Festung Daugavgrīva auf alten Karten auf. Später wurden die Befestigungsanlagen schrittweise erweitert und modernisiert. Während der schwedischen Herrschaft wurde Dolomit für den Bau von Tunneln und Geschützstellungen mit Lastkähnen die Düna entlang transportiert, und zwar aus den Steinbrüchen von Koknese. Mitte des 19. Jahrhunderts begann man mit dem Bau von Anlegestellen in der Düna. Etwa zwanzig bis dreißig Jahre später entstanden hier Bunker aus roten Ziegeln. Zwei der Stahlbeton-Geschützstellungen wurden bereits während der Zeit des unabhängigen Staates Lettland – im Jahr 1934 – errichtet, wie eine mit einem Finger oder einem Zweig in den Beton eingeritzte Markierung belegt. Weiter östlich befinden sich Flakstellungen, die von deutschen Truppen im Zweiten Weltkrieg errichtet wurden. Dies ist der einzige Ort auf Mangalsala, an dem tatsächlich Kampfhandlungen stattfanden: Mitte des 19. Jahrhunderts, während des Krimkriegs, griff die britische Flotte Riga an, doch dank der Befestigungen an der Düna-Mündung verlief der Angriff nicht sehr erfolgreich. Ein halbes Jahrhundert später – am 2. Juli 1919 – während des Lettischen Unabhängigkeitskrieges beschossen estnische Kanonenboote von der Küste aus erfolgreich die Stellungen der deutschen Eisernen Division auf Mangalsala. Im Ersten Weltkrieg waren die Befestigungen der Düna so gewaltig, dass Riga die einzige Stadt an der Ostseeküste war, die die deutsche Flotte nicht angriff. So schützten diese Befestigungen der Düna die Hafentore über Jahrhunderte und verhinderten, dass der Feind nach Riga eindrang.
Achtung! Zum Schutz der überwinternden Fledermäuse (alle Arten stehen unter Schutz) dürfen Sie sich von Oktober bis April nicht in unterirdischen Gebäuden oder Bunkern aufhalten.
Überreste von Übungstorpedos
Laut Augenzeugenberichten lagerte die sowjetische Armee in Mangalsala Munition äußerst nachlässig, was möglicherweise zu von Menschen verursachten Katastrophen führte. Bereits zu Zeiten des Zarenreichs wurde in diesem Gebiet Munition gelagert – sowohl in geschlossenen als auch in offenen Lagern. Während der Sowjetzeit befanden sich hier Munitions- und Seeminenlager der sowjetischen Ostseeflotte. Angeblich gab es in Daugavgrīva eine Torpedowerkstatt.
„In Mangaļi im Bezirk Riga, wo sich unser Minen- und Torpedolager befand, lagerten 400.000 Tonnen Sprengstoff. (…) Darüber hinaus lagerten dort Hunderte von Torpedos, Seeminen, Zünder und allerlei anderer Sprengstoffschrott. Es gab auch eine Werkstatt zur Entschärfung von Sprengladungen. Und einen ganzen Haufen Handfeuerwaffen – von SKS-Karabinern bis hin zu „Parabellum“-Pistolen“, schreibt der ehemalige Offizier, Hauptmann 2. Ranges Andrejs Riskins.
Heutzutage handelt es sich bei den im Wald zu sehenden „Torpedos“ um Übungstorpedorümpfe aus Beton.
Das Wrack des Schiffes "Alar"
Das Schiff „Alar“, auch bekannt als „Ernst Jaakson“, ist eines der bemerkenswertesten historischen Schiffe Estlands. Der 35 Meter lange und 8 Meter breite Dreimast-Motorsegler wurde von 1937 bis 1939 im Dorf Õngu auf der Insel Hiiumaa unter der Leitung von Einheimischen und dem Schiffbaumeister Peeter Himmi gebaut. Es ist das größte erhaltene Holzschiff seiner Art in Estland.
Der erste Kapitän des Schiffes war Arnold Tõri, dessen Vater einer der Reeder war. Anfangs transportierte die „Alar“ Holz, ab 1940 jedoch Baumaterialien zu sowjetischen Militärbasen. Während des Zweiten Weltkriegs blieb das Schiff in estnischen Gewässern. Nach Kriegsende planten Reeder und Besatzung die Flucht nach Schweden, doch der Plan wurde entdeckt und sie wurden verhaftet. Die Schiffsführung wurde in Tallinn inhaftiert, die Deutschen übernahmen jedoch das Schiff, benannten es in „Kurland“ um und brachten es nach Deutschland.
Nach dem Krieg fand Arnold Thiri, der in die Vereinigten Staaten ausgewandert war, das Schiff in Hamburg, brachte es nach England, wo es wiederaufgebaut und in „Arne“ umbenannt wurde. Das Schiff fuhr später unter schwedischer Flagge bis 1968, als es zurückgekauft und zur Restaurierung nach Dänemark gebracht wurde.
1998, nach fast 60 Jahren, wurde das Schiff zurück zur Insel Hiiumaa gebracht und im Hafen von Sõru, dem einzigen Restaurierungszentrum für Holzboote und -schiffe in Estland, vertäut. Im selben Jahr wurde es zu Ehren des langjährigen estnischen Diplomaten Ernst Jaakson, der die Kontinuität Estlands in den Vereinigten Staaten während der Sowjetzeit vertrat, in „Ernst Jaakson“ umbenannt.
Aktuell befindet sich "Alar" im Hafen von Sõru, im Dorf Pärna, auf der Insel Hiiumaa und ist jederzeit frei zugänglich.
Pakri-Inseln – Sowjetischer Luftwaffen-Zielbereich
Die Pakri-Inseln – Vaike Pakri (Klein-Pakri) und Suur Pakri (Groß-Pakri) – liegen im südlichen Finnischen Meerbusen, vor der Stadt Paldiski an der nordwestlichen Küste Estlands. Diese vergleichsweise kleinen Inseln sind ein Beispiel für die vielschichtige Geschichte des militärischen Erbes der Ostseeregion, insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als sie als sowjetisches Flugübungsgelände vollständig militarisiert wurden.
Historischer Kontext und Militarisierung
Nach der Besetzung Estlands 1940 und dem Ende des Zweiten Weltkriegs gerieten die Pakri-Inseln unter direkte militärische Kontrolle der Sowjetunion. Sie wurden vollständig von der Zivilbevölkerung geräumt – die schwedischen und estnischen Eigentümer, die die Inseln bewohnten, wurden zwangsweise aufs Festland umgesiedelt oder vertrieben. Dies war ein typisches Beispiel für die Militarisierung der Ostseeküste während der Festigung der sowjetischen Macht.
Die sowjetische Armee errichtete auf diesen Inseln ein Flugabwehrgebiet. Bomber und Kampfflugzeuge trainierten hier – Flugzeuge vom Festland (insbesondere vom Stützpunkt Paldiski) führten Übungsbombenangriffe durch und zerstörten Ziele auf den Inseln. Es wurden spezielle Zielattrappen aus Beton und Metall sowie Beobachtungs- und Kommandoposten errichtet. Die Topografie und die geografische Isolation der Inseln machten sie zu einem idealen Übungsgebiet, da die Zerstörungen durch Explosionen und Bombenangriffe die Zivilbevölkerung und Infrastruktur auf dem Festland nicht gefährdeten.
Materielle Zeugnisse des militärischen Erbes
Die Pakri-Inseln sind heute praktisch ein Freilichtmuseum, in dem man die militärische Infrastruktur des Kalten Krieges studieren kann. Auf den Inseln finden sich nachgebildete Betonziele, Bombenkrater, Trümmer von Gebäuden, Bunkerruinen und Beobachtungsposten. Auch Blindgänger liegen an mehreren Stellen – trotz regelmäßiger Minenräumungsaktionen ist eine völlig sichere Fortbewegung nicht gewährleistet. Das macht die Inseln nicht nur zu einem interessanten, sondern auch zu einem gefährlichen Ort des militärischen Erbes.
Die Inseln veranschaulichen auch den ingenieurtechnischen Ansatz des sowjetischen Militärs: Der Bau des Übungsgeländes war funktional, standardisiert und äußerst langlebig, wobei die lokale Umwelt und das kulturelle Erbe kaum berücksichtigt wurden. Gleichzeitig war es gerade diese massive, oft überdimensionierte Bauweise, die das sowjetische Militärerbe so beständig machte – selbst Jahrzehnte nach der Schließung des Übungsgeländes sind seine Spuren deutlich sichtbar.
Vertreibung von Menschen und Umgestaltung der Kulturlandschaft
Die Militarisierung der Pakri-Inseln bedeutete auch eine vollständige Umgestaltung der Kulturlandschaft. Die dort seit Jahrhunderten ansässige Bevölkerung (mit starken schwedischen Siedlertraditionen) verlor ihre angestammte Umgebung. Die Inseln wurden zu einer geschlossenen Militärzone, in der das zivile Leben ausgelöscht wurde – ein typisches Beispiel für sowjetischen strategischen Raum.
Die Zeit der Unabhängigkeit und der tragische Vorfall
Nachdem Estland seine Unabhängigkeit wiedererlangt hatte, begann die sowjetische Armee, die Inseln Paldiski und Pakri aufzugeben. Das militärische Erbe verschwand jedoch nicht über Nacht. In den 1990er Jahren wurden Versuche unternommen, die Kontrolle über diese gefährlichen und verlassenen Gebiete zurückzuerlangen. Eine der tragischsten Episoden ereignete sich im März 1997: Eine Einheit der estnischen Polizei und der Grenzschutz-Spezialkräfte versuchte, die Insel Suur Pakri zu Fuß über den flachen Meeresboden zu erreichen. Starke Winde und eiskaltes Wasser machten die Bedingungen lebensgefährlich – mehrere ausgebildete Männer ertranken.
Vermächtnis und Zukunft
Heute sind die Pakri-Inseln ein Naturschutzgebiet. Ironischerweise trug die lange militärische Isolation tatsächlich zum Erhalt der Artenvielfalt bei – der Abzug der Menschen ermöglichte es der Natur, das Gebiet zurückzuerobern. Die Gefahr der Kontamination durch sowjetische Mülldeponien und Blindgänger bleibt jedoch ein ernstes Problem.
Die Pakri-Inseln sind ein eindrucksvolles Beispiel für die Problematik des postmilitärischen Erbes im Baltikum: Hier treffen Spuren strategischer Geschichte, erzwungener Vertreibung und Identitätsverlust, ökologischer Zerstörung und zugleich unerwarteter natürlicher Regeneration aufeinander. Sie sind auch materielle Zeugnisse des geopolitischen Raums des Kalten Krieges – wie kleine Inseln zu Instrumenten globaler Militärinteressen werden konnten und wie diese Vergangenheit unsere Sicht auf Landschaft und Geschichte bis heute prägt.
Angesichts der potenziellen Gefahren wird empfohlen, die Pakri-Inseln nur in Begleitung eines einheimischen Führers zu besuchen.
temporärer Flugplatz Vatla
Der provisorische Flugplatz Vatla ist ein etwa 2.500 m langer, mit Beton und Asphalt befestigter Streifen – eine traditionelle Variante eines „Straßenflugplatzes“, der als Reserveflugplatz für die Luftstreitkräfte der UdSSR zur schnellen Mobilisierung dient.
Diese Art von Anlage (im Englischen „highway strip“ oder „road runway“) wurde in den Ländern des Sowjetblocks häufig genutzt.
Vatla liegt an der Straße zwischen Karuse und Kalli.
WW2 – Ausstellung des Zweiten Weltkriegs
WW2 – Ausstellung des Zweiten Weltkriegs in Aglona bzw. das Kriegsmuseum wurde 2008 gegründet und ist eine der umfangreichsten und interessantesten Ausstellungen dieser Art in Lettland. Die Sammlung wird laufend durch Neuerwerbungen, Geschichten von Kriegsteilnehmern und Menschen der Kriegsgeneration bereichert.
Der Kern des Museums besteht aus Waffen, Ausrüstung, Munition und Uniformen, die im Zweiten Weltkrieg verwendet wurden. Darüber hinaus gibt es Haushaltsgegenstände, Flugzeugwracks und andere Exponate. Eines der wertvollsten und einzigartigsten Exponate ist die Feldpost-Korrespondenz zwischen Oberleutnant August und seiner Geliebten Marta, die während der fünf Kriegsjahre einen Dialog zwischen zwei liebenden Menschen mit einem glücklichen Ende schuf. Im Hintergrund sind Chroniken aus der Kriegszeit zu sehen.
Die Ausstellung ist unpolitisch und spiegelt beide Seiten des Krieges gleichermaßen wider, so dass der Betrachter sie wahrnehmen kann, ohne über Gut oder Böse zu urteilen, was sie leicht verständlich macht
Ārdava (Jezufinova) Manor
Ārdava war während des Zweiten Weltkriegs ein wichtiger militärischer und strategischer Standort, an dem sowohl Partisanenaktivitäten als auch andere militärische Ereignisse stattfanden.
Das Herrenhaus im Stil der Neorenaissance wurde ursprünglich zwischen 1860 und 1863 für die Adelsfamilie Mol erbaut. Der Gutsbesitzer, Václav Mol, hatte dort eine Privatschule für seine eigenen Kinder und die Kinder seiner Bediensteten eingerichtet, in der er Lettisch und Russisch, Schreiben und Rechnen unterrichtete.
Im Jahr 1922 wurde im Herrenhaus die Ārdava-Grundschule gegründet, die bis 2003 bestand.
Die Schule war das Zentrum des Lebens in Ārdava – sie diente zugleich als Gasthaus und Veranstaltungsort für Hochzeiten, Feiern und ähnliche Anlässe und war das ganze Jahr über in Betrieb. Bis zur deutschen Besatzung wurde das Herrenhaus mit Petroleumlampen beleuchtet, später wurde ein Generator installiert. Regenwasser wurde in den Dachrinnen aufgefangen und zum Wäschewaschen verwendet, da es keinen Kalk enthielt und die Kleidung weicher machte. Jedes Zimmer verfügte über einen Holzofen, zusätzlich gab es einen Holzheizofen mit Steinkaminen, in denen sich die heiße Luft sammelte und die Wärme speicherte.
Das Leben an der Ārdava-Grundschule im Ārdava-Herrenhaus von 1934 bis 1943, wie Lidija Odeiko und Vija Liepa (geb. Odeiko) es ihrer Familie erzählten.
Helen Broka (1905–1975) war die Tochter eines Bauern aus dem Dorf Lieli Leimaņi. Alberts Odeiko (1903–1938) war der Sohn eines Fabrikarbeiters aus Riga. Helen und Alberts lernten sich in Aglona kennen und heirateten dort 1927. Sie lebten im Dorf Somerset, wo 1930 ihre älteste Tochter Lidija und 1932 ihre zweite Tochter Vija geboren wurden. 1934 wurde Helen zur Schulleiterin der Grundschule des Gutshofs Ārdava ernannt.
Kriegsereignisse: 1940
Nach dem Einmarsch der Sowjetunion im Frühjahr 1940 wurde Helen von ihrer Position als Schulleiterin abberufen, durfte aber weiterhin als Lehrerin arbeiten. Ein Lehrer namens Jachuk übernahm daraufhin die Schulleitung.
Kriegsereignisse: 1941
Die Familie wohnte im linken Flügel des Gebäudes. Im Sommer 1941, als die Deutschen einmarschierten und die Sowjets vertrieben, hielten sich Helen und die Mädchen bei Donāt in Lielai Leimaņi auf. In dieser turbulenten Zeit mussten sie sich im Wald verstecken. Als sie schließlich nach Ārdava zurückkehrten (nachdem die Deutschen im Juli Lettland vollständig besetzt hatten), erfuhren sie, dass Helen auf der sowjetischen Liste der Massendeportationen vom Juni 1941 stand.
Das deutsche Hauptquartier befand sich im Sommer 1941 in Ārdava, nachdem die deutsche Armee das Gebiet kurz nach der Einnahme von Riga im Juli 1941 besetzt hatte. Das Gutshaus von Ārdava, das zuvor die örtliche Grundschule beherbergt hatte, wurde für die Bedürfnisse der deutschen Truppen genutzt. Die Deutschen richteten ihr Hauptquartier in dem Gutshaus ein, da die nahegelegene Eisenbahnlinie direkt zur Ostfront führte. Die meisten von ihnen waren keine Soldaten, sondern Militärangehörige, die für die Versorgung und Logistik zuständig waren. Es wurde Strom installiert, und Treibstofffässer für den Generator wurden auf der Straße zum Haus vergraben. Draußen wurden Wassertanks aufgestellt, die erstmals fließendes Wasser zum Trinken und Kochen bereitstellten.
Kriegsereignisse: 1942
Am 17. Juni 1942 ereignete sich am Bahnhof Ārdava eine Explosion, die von den Roten Partisanen organisiert worden war. Sie erinnerte an die Ereignisse des 17. Juni 1940 und den Einmarsch der Roten Armee in Lettland. Ein Munitionszug, der zur russischen Front unterwegs war, explodierte am Bahnhof Ārdava, etwa 0,5 km vom Gutshof Ārdava entfernt. Durch die Explosion wurde der Bahnhof zerstört, und es gab Opfer – die Familie Mickāns kam ums Leben: ihr Sohn, der Journalist und Schriftsteller Vincents Mickāns, sein Vater, der Eisenbahner Joachims Mickāns, und ihre Mutter Petronelija Mickāne, die ihren Verletzungen erlag. Die gesamte Familie ist auf dem Friedhof von Aglona begraben. [1] Laut den Memoiren der Einwohner von Ārdava war geplant, das Schulgebäude bei einem Rückzug der Deutschen in die Luft zu sprengen, da die Partisanen von Ārdava im Keller Minen gefunden hatten.
Kriegsereignisse: 1944
Als die deutsche Ostfront im August 1944 zusammenbrach und sowjetische Truppen näher rückten, brachte Helen die Mädchen zu ihren Eltern, um sie in Sicherheit zu bringen. Sie selbst kehrte nach Ārdava zurück, wo die Deutschen ihren Rückzug vorbereiteten. Da die Deutschen wussten, dass Helen ein Ziel der Sowjets war, boten sie ihr an, mit ihnen zu gehen, und schlugen vor, dass sie die Kinder mitnehmen sollte, damit die Familie nicht getrennt würde. Sie packten ihre Habseligkeiten in Decken und bestiegen einen Lastwagen, der sie nach Daugavpils brachte. Von dort brachten die Deutschen sie auf einen Bauernhof in Vidzeme, wo sie sich etwa eine Woche lang versteckten, bis die Soldaten zurückkehrten und sie nach Riga brachten. Die Familie Odeiko ging nach Wien, wo Helen Arbeit fand, während die Mädchen auf einem Bauernhof im nahegelegenen Ramsau lebten. Im Frühjahr zogen sie auf einen Bauernhof in der Nähe von Fleischwangen, und nach Kriegsende konnten die Mädchen ihre lettische Schule im nahegelegenen Ebenweiler wieder besuchen. Helen und Vija gingen 1950 in die Vereinigten Staaten.
Jānis Pīnups, der dienstälteste Partisan Lettlands, lebte in Ārdava. 1944 wurde er in die Rote Armee eingezogen, desertierte jedoch und versteckte sich über fünfzig Jahre lang im Wald der Gemeinde Pelēči in Latgale. Erst am 9. Mai 1995, im Alter von siebzig Jahren, legalisierte er seine Staatsbürgerschaft. Er wurde als letzter „Waldbruder des Zweiten Weltkriegs in Lettland“ bezeichnet, obwohl er nicht am bewaffneten Kampf gegen das Sowjetregime teilgenommen hatte. Jānis Pīnups’ Lebensgeschichte diente Jānis Baložs als Grundlage für seine Dramaturgie des Lettischen Nationaltheaters für das Stück „Mežainis“.
[1] Quellen: „Das dritte Opfer des tragischen Unfalls ist gestorben.“ Daugavas Vēstnesis. 1942. 26. Juni: „Vincents Mickāns liegt im Schoß der Erde.“ Daugavas Vēstnesis. 1942. 20. Juni, Mazjānis, R. „Vincents Mickāns (Foto).“ Daugavas Vēstnesis. 1942. 21. Juni.
Verlassener Ölstützpunkt der sowjetischen Armee in Borowka
Die einfachste Art, in die Vergangenheit zu reisen, ist vielleicht der Besuch längst vergessener Orte. Ein solcher Ort befindet sich in Borovka in der Region Krāslava – eine verlassene Ölbasis aus der Sowjetzeit.
Eine breite, asphaltierte Straße führt durch den Wald zum Militärstützpunkt. Man könnte meinen, sie sei beleuchtet, denn an den Seiten stehen Straßenlaternen in einem für die Sowjetzeit typischen Design.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde auf der Krāslava-Seite – in Borovka – ein für die Armee geeignetes Gelände gefunden, und 1950 begannen die umfangreichen Bauarbeiten. Der 237 Hektar große Stützpunkt war als strategische Ölreserve für das baltische Kriegsgebiet mit einer Kapazität von 600.000 Tonnen konzipiert. Die Katasterlisten verzeichnen 133 Gebäude auf dem verlassenen Militärgelände. Ein Großteil der Gebäude ist erhalten geblieben, befindet sich aber in einem kritischen Zustand.
Verrostete Warnschilder sind an vielen Stellen verstreut: „Bei Gewitter nicht nähern!“; „Rauchen ist ein schwerwiegender Verstoß!“; „Offenes Feuer verboten.“
Früher gab es hier Dutzende riesige Öltanks, unterirdische Bunker, Hangars, Eisenbahninfrastruktur, Rohrleitungen, durch die Heizöl gepumpt und in Tanks gefüllt wurde, sowie Garagen, Verwaltungs- und Betriebsgebäude.
Nach dem Abzug der Armee wurde das Heizöl von dem städtischen Unternehmen Daugavpils in den Tanks gelagert, und die Latgale-Niederlassung der Zollverwaltung nutzte das Verwaltungsgebäude für einige Zeit. Heute gehört das Gelände dem Staatseigentum.
Beim Besuch des Geländes ist Vorsicht geboten; es ist nicht sicher, sich zwischen den Gebäuden zu bewegen, da tiefe, ungedeckte Brunnen, Landinvasionen usw. unbemerkt im Gras verborgen sein können.
GPS-Koordinaten: 55.916591, 26.96874
Fähre Dignāja–Līvāni
Die Fähre besteht aus Pontons der russischen Armee, einer Pontonbrücke, die ursprünglich für den Transport von Panzern gedacht war. Diese Module wurden verstärkt und zu einer Pontonbrücke umgebaut, um den Transport von Militärgerät zu ermöglichen. Konkret handelt es sich bei dieser Fähre um ein Überbleibsel der Besatzungszeit.
Die Fähre verbindet die Ufer der Düna und ist die direkteste Verbindung von Latgale nach Sēlija und Zemgale. Für viele mag sie exotisch wirken, doch für die Anwohner der Flussufer ist sie ein unverzichtbares Verkehrsmittel. Die Fähren werden sowohl von Fußgängern als auch von Auto- und Fahrradfahrern genutzt. Sie bieten zudem die Möglichkeit, die Vergangenheit hautnah zu erleben. Derzeit verkehren in Lettland nur zwei Fähren – in Līvāni und Līgatne.
Wichtiger Hinweis: Große Busse können nicht angehoben werden, da sie zu niedrig sind und daher nicht auf die Umsteigeplattform fahren können. Kleinbusse mit bis zu 20 Sitzplätzen können umgeladen werden.
Denkmal für Jānis Vītiņš
Jānis Vītiņš (1894-1941) war nicht nur ein großartiger Sänger, sondern auch ein heldenhafter Soldat. Für seinen Heldenmut in den Schlachten bei Bolderaja im Jahr 1921 wurde Jānis Vītiņš mit dem Lāčplēsis-Kriegsorden ausgezeichnet.
Die Wallburg Spārni und das Haus „Guntiņas“ wurden J. Vītiņš in den 1930er Jahren vom lettischen Staat für seine Heldentaten im lettischen Freiheitskampf geschenkt. Am 21. Juni 2019 wurde in Īle, am Fuße der Wallburg Spārni, ein Denkmal enthüllt.
Der Gedenkstein wurde unter der Leitung der Bildhauerin Iveta Smiltniece geschaffen und spiegelt symbolisch Jānis Vītiņš' Beitrag zu Lettland wider:
„Es handelt sich um einen in zwei Hälften geteilten Felsbrocken, wobei die eine Seite die militärischen Heldentaten von Jānis Vītiņš und die andere Seite seine Leistungen in der Opernmusik darstellt.“
„Jānis Vītiņš wurde am 14.10.1894 in Pullā, Gemeinde Dzērve, heute Gemeinde Cīrava, geboren. Gestorben: 29.11.1941 in Astrachan, Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik, KPFSR. Im Gefängnis von Astrachan durch ein Erschießungskommando zum Tode verurteilt.
J. Vītiņš wurde als Sohn des Bauern Fričis geboren, wo auch seine drei Geschwister Kārlis, Matilde und Bille (Betija) aufwuchsen. Er besuchte die Grundschule in Rāva, die Handelsschule Činka in Liepāja und anschließend die Fähnrichschule in Pskow. Aus seiner Heirat mit Erna im Jahr 1922 ging sein Sohn Gunārs hervor.
1915, während des Ersten Weltkriegs, wurde J. Vītiņš in die russische Armee eingezogen. Er diente im 9. Ural-Infanterieregiment und ab 1917 in der 2. Selbstständigen Schweren Artilleriedivision. Im Unabhängigkeitskrieg 1919 wurde J. Vītiņš in die lettische Armee eingezogen und diente im Rang eines Oberleutnants. Ab Februar 1919 war er Organisator und Ausbilder der Nationalgarde und diente später in den neu aufgestellten Streitkräften sowie in einem selbstständigen Bataillon. Während seiner Militärzeit trat J. Vītiņš öffentlich auf und schloss sich einem Vokalquartett an.
Nach der Gründung des Lettischen Volksrats in Liepāja wurde J. Vītiņš Mitglied der sozialdemokratischen Fraktion. Im Sommer 1919 wurde er zum Ausbilder der Freiwilligenkompanie der Rigaer Neuen Streitkräfte ernannt und später deren erster Kompaniechef. Er war außerdem Chef der Militärpolizei und wurde anschließend zum 8. Infanterieregiment „Daugavpils“ versetzt. Während der Bermontiaden wurde J. Vītiņš in Kämpfen an der Jelgava-Straße verwundet.
Nach seiner Demobilisierung im Jahr 1920 trat J. Vītiņš in das Lettische Konservatorium ein, studierte Gesang (bei Ernests Witting), sang gleichzeitig im Nationalen Opernchor und erhielt bald kleinere Rollen. Sein Debüt gab er als Wilhelm in Ambroise Thomas’ Oper „Mignon“. 1929 wurde er vom Opernhaus Zagreb (Jugoslawien) engagiert. Im Laufe seiner Karriere sang der Tenor J. Vītiņš 36 Opernrollen, die meisten davon in den 1930er Jahren, als er in vielen europäischen Opernhäusern gefragt war. Von 1931 bis 1937 trat der Sänger unter dem Künstlernamen Jan Wittin in Deutschland auf – an der Berliner Volksoper, in Dessau, Leipzig, Köln, Duisburg, Stettin, Breslau und Essen – sowie in der Tschechoslowakei, Jugoslawien, der Schweiz und den Niederlanden.
1940, unter sowjetischer Besatzung, schloss sich J. Vītiņš der Widerstandsbewegung „Hüter des Vaterlandes“ an. Am 6. März 1941 wurde er in seiner Wohnung in Riga, in der Baložu-Straße, verhaftet und fälschlicherweise der Spionage für Deutschland beschuldigt. Am 15. März wurde der Sänger gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a des Strafgesetzbuches der Kommunistischen Partei der Sowjetunion wegen „Verrats am Vaterland“ vom Militärgericht der Garnison Stalingrad zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung wurde am 29. (oder 12.?) November 1941 im Gefängnis von Astrachan vollstreckt. J. Vītiņš’ Witwe und sein Sohn wurden verfolgt (deportiert).
Im Jahr 2018 wurde das Andenken an den herausragenden Tenor und Patrioten mit der Aufführung der Oper „André Chénier“ beim Opernfestival in Sigulda geehrt. J. Vītiņš’ Name ist auf einer Gedenkstele eingraviert, die am 11.11.2018 im Aizpute Misiņkalns Park enthüllt wurde. 2019 wurde an J. Vītiņš’ Haus am Fuße des Burghügels von Spārni in der Gemeinde Īle eine Gedenktafel enthüllt. Im Lettischen Nationalen Opern- und Balletthaus ist J. Vītiņš’ Name auf einem Stuhl in der 14. Reihe, an erster Stelle, eingraviert.
Nationale Enzyklopädie, Autor Daiga Azvērsīte.
Zugehörige Geschichten
Verbotene Leuchttürme und Küste
Zu Zeiten der UdSSR waren die Meeresküsten in Nord- und West-Kurzeme eigentlich militärische Sperrgebiete, aber es war verboten, die Leuchttürme zu besuchen oder gar zu fotografieren.
Die vergessene Küste Livlands
Die letzten livischen Dörfer an der Nordwestküste Lettlands wurden seit 1950 systematisch zerstört und von den Räten zur Sperrzone erklärt. Nur eine Handvoll dieser Menschen überlebte in 12 Fischerdörfern, und sie erleben derzeit eine Art kulturelle Renaissance.
Auf den Spuren eines Spions
Das Gedächtnis der Leute ist manchmal recht kurz. Heute, wo jeder hingehen kann, wohin er will, beklagen sich viele über die verschwundene Billigwurst, haben aber längst vergessen, dass direkt hinter Mērsrags, vor der Straße, oft eine gestreifte Bombe einschlug und bewaffnete russische Soldaten, die sogenannten Grenzsoldaten, sie nur mit schriftlichen und gestempelten Genehmigungen durchließen. Und nicht jeder Einwohner der Lettischen SSR konnte eine solche Genehmigung erhalten, sondern nur diejenigen, die zuvor eine sogenannte Vorladung vom Gemeinderat von Roja oder Kolka erhalten hatten. Auf dieser Grundlage konnten sie nach zehn Tagen bei ihrer Milizeinheit ein Visum für die Einreise in die gesperrte Grenzzone erhalten (oder auch nicht). Ich hatte ein Haus an dieser unglückseligen Küste Kurlands gekauft, und so mussten meine Familie und ich jeden Frühling beten und demütig sein, damit die Behörden die Einreisegenehmigung verlängerten.
Meuterei auf dem Kriegsschiff „STOROZHEVOYA“
Am 8. November 1975 fand in Riga, wie in der UdSSR üblich, eine weitere große Feier zum Jahrestag der bolschewistischen Revolution statt. Niemand, auch nicht in seinen kühnsten Albträumen, hätte sich vorstellen können, dass der 58. Jahrestag der Revolution in die Geschichte Lettlands und der UdSSR als etwas noch nie Dagewesenes und noch nie Dagewesenes eingehen würde - eine Meuterei an Bord der Storoževoj, einem großen U-Boot-Abwehrschiff. 15 Jahre lang leugnete die UdSSR, dass an Bord eine Meuterei stattgefunden hatte.
Überquerung der Grenzregimezone
Eine „Propusk“ oder Erlaubnis zum Überqueren der Grenzregimezone war genauso obligatorisch wie eine Busfahrkarte.
Gefälschter Bernstein auf der Liepāja-Seite
Seit mehr als zwanzig Jahren ist die Küste von Liepāja aufgrund von falschem Bernstein gefährlich, den das Meer besonders während der Frühlings- und Herbststürme in großen Mengen aus seinen Tiefen anspült.
Fluchtversuch aus der UdSSR
Junge Leute und Ausländer, die mit der Sowjetzeit nicht vertraut sind, werden es schwer finden zu glauben, dass es für einen sowjetischen Bürger praktisch unmöglich war, die UdSSR legal zu verlassen.
Minen, Bomben, Torpedos und chemische Waffen in der Ostsee
Anfang Februar 2010 wurden im schwedischen Fernsehsender SVT Nachrichten ausgestrahlt, die viele schockierten und zutiefst überraschten.
„PZ“ – Grenzzone
Erinnerungen von Andris Zaļkalns, Vorsitzender des Gemeinderats von Vērgale (1982-1989), über das Leben in der Grenzregion.
„Das Kernkraftwerk der Lettischen SSR wird hier sein!“
Erinnerungen von Andris Zaļkalns (geb. 1951, Vorsitzender des Rates der Volksdeputierten des Dorfes Vērgale (1982-1989)) an die Zeit, als in Akmeņrags beinahe ein Kernkraftwerk gebaut worden wäre.
Beschädigung der Irbene-Radioteleskope
Bevor sie Irbene verließen, beschädigte die sowjetische Armee alle Radioteleskopsysteme
Slītere-Staatsreservat in der Grenzregimezone
Erinnerungen ehemaliger Mitarbeiter des staatlichen Naturschutzgebiets Slītere an die Sowjetzeit.
Grenzregimezone
Über die Zeiten in der Grenzregion.
„Wind. Groll. Und die livländische Flagge.“ (Fragment) – Geisterschiffe und Stacheldraht
Gunta Kārkliņas Erinnerungen an die Sowjetzeit an der livländischen Küste – wie kam es dort zu dem Bootsfriedhof?
Über Upīškalns ehemaliges Militärobjekt
Erinnerungen von Valdis Pigožns (ehemaliger Leiter der Gemeinde Kurmale während der Operation von "Upīškalns") an den Militärstützpunkt Upīškalns
Beobachtungsturm der Grenzschutzbehörde von Kolka
Während der Sowjetzeit überwachten und kontrollierten Grenzbeamte von diesem Turm aus die Gewässer der Irbe-Straße, und damals hieß es, dass nicht einmal eine Ente diese Meerenge durchschwimmen konnte, ohne dass die Grenzbeamten es bemerkten.
Über die Beziehungen Košradzniekis zu sowjetischen Soldaten
Imants Upners Erinnerungen an die Sowjetzeit.
Über die Grenzbeamten von Kalkutta
Baiba Šuvcāne, eine Einwohnerin von Kolka, erzählt von den Zeiten, als es in Kolka noch Grenzsoldaten gab.
Über die Küstengrenzwache von Kalkutta
Die Einwohnerin von Kolka, Valija Laukšteine, erinnert sich an die Zeit, als es in Kolka noch Grenzsoldaten gab.
Militärflugplatz in der Nähe von Tukums
Die kaum sichtbaren, grasbewachsenen Hangars an der Straße nach Tukums beherbergten zu Sowjetzeiten Kampfflugzeuge der Armee. Schon damals waren Flugfeld und Hangars getarnt, und die Ortsunkundigen ahnten nichts davon.
UdSSR-Armeestützpunkt in Marcien
Das Baltikum bildete eine der wichtigsten Verteidigungslinien des Sowjetimperiums, die westlichste Bastion, weshalb dort eine enorme Truppenkonzentration herrschte. Lettland galt damals als das am stärksten militarisierte Gebiet der Welt. Die genaue Zahl der Soldaten ist unbekannt; verschiedene Quellen nennen für unterschiedliche Zeiträume 200.000 bis 350.000. Allein in Lettland waren innerhalb von 50 Jahren 3.009 Militäreinheiten an über 700 Standorten stationiert. Einer dieser Standorte war der sowjetische Armeestützpunkt in Mārcienė.
Über die nationale Partisanengruppe von D. Breikšs
Die Gedenkstätte wurde an der Stelle der ehemaligen Häuser „Daiņkalni“ und „Graškalni“ in der Gemeinde Rauna errichtet, unter denen sich von 1950 bis 1952 eine Gruppe nationaler Partisanen unter der Führung von Dailonis Breikšis (Spitzname Edgars, 1911-1952) in Bunkern versteckte.
Waldtochter Domicella Zwerg (Lucia)
Domicella Pundure ist 90 Jahre alt. Am 3. Mai 2018 erhielt sie auf Schloss Riga von Präsident Raimonds Vējonis den Viesturas-Orden für ihre besonderen Verdienste im nationalen Widerstand und bei der Verteidigung der Unabhängigkeit des Landes. Domicella Pundure ist die letzte Augenzeugin der Schlacht im Stompaku-Sumpf.
Pēteris Supe – Initiator der Gründung des Lettischen Nationalen Partisanenverbandes
Von 1944 bis 1946 gelang es Pēteris Supe, die in den Wäldern verstreuten nationalen Partisaneneinheiten zu einer organisierten Bewegung zu vereinen, die den Kampf gegen die Besatzung Lettlands im Kreis Abrene noch mehrere Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg fortsetzte. Pēteris Supe, genannt „Cinītis“, war einer der herausragendsten Organisatoren und Anführer der nationalen Partisanenbewegung in Nordlatgale.
Das Leben von General Jānis Baložs nach seiner Rückkehr aus dem Exil
Als die Russen 1940 versuchten, der lettischen Regierung ein für sie vorteilhaftes Militärstützpunktabkommen abzuringen, das den Widerstand der lettischen Armee gegen die Rote Armee nahezu unmöglich gemacht hätte, bemühte sich General J. Balodis um einige Änderungen des Abkommens. Dies scheiterte jedoch. Seine Gegner nutzten diesen Umstand später, um ihn beinahe als Verräter darzustellen. Nach einem Konflikt mit dem Premierminister und Staatsminister K. Ulmanis wurde der General am 5. April 1940 als Kriegsminister entlassen. Daraufhin beschloss J. Balodis, für den Demokratischen Block an den Saeima-Wahlen teilzunehmen, doch dies blieb erfolglos, da nur eine Liste zugelassen war – die der kommunistischen Kandidaten. Lettland wurde die 14. Sowjetrepublik.
Über die Besetzung Lettlands
Im Jahr 1940 wurde die Existenz des unabhängigen Staates Lettland durch die Besetzung und Annexion bzw. Eingliederung durch die Sowjetunion in die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) unterbrochen.
Über das Salaspils-Denkmal als Symbol der Ideologie des sowjetischen Besatzungsregimes.
Die Beschreibung verdeutlicht eindrücklich, in welchem Ausmaß die Gedenkstätte politisiert wurde und welche Rolle sie in der Ideologie der Sowjetunion spielte. Der Text erwähnt, dass eines der Hauptziele der Kampf gegen die „Wiedergeburt des Faschismus“ war. Dies deutet darauf hin, dass weiterhin versucht wird, die ideologische Infrastruktur zu nutzen, um die Verbrechen der Kommunisten zu verschleiern und abweichende Meinungen zu unterdrücken. Gedenkstätten, Friedhöfe und Museen der sowjetischen Armee sowie diverse Kulturveranstaltungen hielten den Mythos der „Befreiung Lettlands“ und der „brüderlichen Sowjetunion“ aufrecht. Die Fakten der NS-Verbrechen wurden instrumentalisiert, um ein verzerrtes Bild der Ereignisse des Zweiten Weltkriegs in Lettland zu zeichnen.
Exhumierung von Soldaten der Sowjetarmee in der Gemeinde Blīdene im Jahr 2019
Im Juli 2019 exhumierte der Soldatensuchtrupp "Leģenda" die Asche von 66 Soldaten in einem Wald in der Gemeinde Blīdene. Aufgrund von Oberflächlichkeit oder Versäumnissen während der Sowjetzeit gelten die meisten dieser Soldaten als offiziell in den Sowjetjahren umgebettet. Die Namen dieser Soldaten sind sogar auf den Grabsteinen auf dem Brüderfriedhof Tuški eingraviert.
Überfall auf den Flugplatz Vaiņode im Jahr 1941
Die Geschichte des deutschen Luftangriffs auf den Flugplatz Vaiņode im Juni 1941
Management des Reserveflugplatzes Tukums in den 1990er Jahren.
Mit dem Abzug der sowjetischen Besatzungstruppen begann die Plünderung zahlreicher ehemaliger Militärbasen. Sowjetische Soldaten versuchten, so viel wie möglich mitzunehmen und die Infrastruktur in einem desolaten Zustand zurückzulassen. Nach dem Abzug der Truppen plünderten Zivilisten diese Basen weiter und nutzten die ehemalige Militärinfrastruktur aus.
Über die gefundenen Kriegsartefakte
Im modernen Lettland werden die Sammlungen verschiedener Museen durch private Sammlungen ergänzt, die oft öffentlich ausgestellt und für alle zugänglich sind. Viele Menschen hegen eine Leidenschaft für alte Dinge, darunter auch Objekte mit Bezug zur Militärgeschichte. Oftmals wissen die Besucher nichts über deren Herkunft. Sind sie einfach so aufgetaucht? In jedem Fall steckt jahrelange Arbeit und eine interessante, persönliche Geschichte über das Sammeln von Gegenständen, um beispielsweise ein Museum daraus zu gründen. Der Erzähler beschreibt seine persönlichen Erfahrungen und vermittelt dem Leser einen Eindruck von der Situation in Lettland nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Erbe der verschiedenen Armeen und der Mangel an Rohstoffen in der Landwirtschaft zwingen die Menschen, kreative Wege zu finden, praktisch alles zu nutzen, um zu überleben. Im Laufe der Zeit werden die vermeintlich nutzlosen Gegenstände zu wertvollen historischen Exponaten, die die Geschichte Lettlands und seiner Bevölkerung erzählen.
Erzählen Sie mir etwas über die versunkene Ausrüstung.
In Lettland sind zahlreiche Geschichten über in Sümpfen und Seen versunkene Maschinen überliefert. Nur wenige von ihnen sind wahr.
Militärpatriotische Spiele im Juli 1976 auf dem Panzerübungsplatz „Orlenok“ bei Irbene
Juli 1976 militärisch-patriotische Spiele "Orlenok" auf dem Panzerübungsplatz bei Irbene, an denen der 17-jährige Evalds Krieviņš teilnahm und heimlich die Spiele, die Ausrüstung und sogar die Antenne von Irbene mit einer Sme8M-Kamera fotografierte
Streiche und Spiele mit Militärmunition
Nach dem Zweiten Weltkrieg war Lettland von den physischen Überresten des Krieges übersät. Es gab unzählige Granaten, Blindgänger und Patronenhülsen. Selbst heute noch findet man, insbesondere an Orten, an denen aktiv Krieg geführt wurde, Blindgänger – eine große Seltenheit. In den Nachkriegsjahren hingegen gehörten diese Granaten zum Alltag der Bewohner, sowohl in Wäldern als auch in Gärten, und sogar im Spielzeug von Kindern.
Das Leben während des Zweiten Weltkriegs auf der Kegums-Seite
Erinnerungen an die längst vergangene königliche Ära blitzten auf. Die ältere Generation würde sich an ihre eigenen Erlebnisse erinnern, die jüngere hingegen könnte sich langweilen.
Erinnerungen aus einem zurückgelassenen Tagebuch – Dienst im Wasserkraftwerk Ķegums
Jānis Jaunozoliņš. „Erinnerungen aus einem im Ausland hinterlassenen Tagebuch“ (16.08.1944.-13.10.1946.) Fragmente.
Verwundung von Generalmajor N. Dedayevs in der Festung Liepāja, Vidus-Festung
Im Juni 1941 hatte der erfolgreiche Angriff der deutschen Armee Liepaja erreicht, als Liepaja von der 291. Infanteriedivision der deutschen Panzertruppen angegriffen wurde. Als die Feindseligkeiten zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion im Juni 1941 begannen, bestand die Liepaja-Garnison der Sowjetarmee aus Truppen des Liepajaer Marinestützpunkts der Marine und der Roten Armee. Während dieser Kämpfe wurde Generalmajor N. Dedajew tödlich verwundet.
Die Geschichte des Feuerleitturms der 46. Küstenverteidigungsbatterie in Ventspils
Das militärische Erbe von Ventspils ist einzigartig, weil es eine der wenigen Küstenverteidigungsanlagen in Lettland und im Baltikum ist, die die Geschichte der Befestigungen des Zweiten Weltkriegs widerspiegeln. Sie ist auch deshalb einzigartig, weil es sich um ein militärisches Objekt handelt, das von der Sowjetunion in den Jahren der Unabhängigkeit der Republik Lettland gebaut wurde und in gewisser Weise die Unfähigkeit eines kleinen Landes symbolisiert, sich den Supermächten am Vorabend des Zweiten Weltkriegs entgegenzustellen. Sie ist die einzige Küstenverteidigungsbatterie, die so gut erhalten geblieben ist, ohne historische Schichten und in ihrem vollständigen Bauzustand. Die Anlage zeigt die gesamte Entwicklung des sowjetischen Militärkonzepts von 1939 bis zum Abzug der sowjetischen Truppen im Jahr 1994.
Liepāja – am Schnittpunkt verschiedener historischer Ereignisse
Die Einwohner von Liepāja gehörten zu den ersten in Lettland, die den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erlebten, und zu den letzten, für die der Krieg sowohl buchstäblich als auch symbolisch endete. Der Zweite Weltkrieg und die sowjetische Besatzung von Liepāja endeten erst 1994, als die letzten Truppen des Erben der UdSSR, Russland, die Stadt verließen.
Das Schicksal von Krasnoflotsk nach dem Abzug der Sowjets
Nachdem die letzten sowjetischen Truppen 1993 Lettland verlassen hatten, ging auch die Küstenschutzbatterie Krasnoflotsk oder Olmani in den Besitz der lettischen Verteidigungskräfte über. Schon bald wurde der verwaiste Besitz von gewinnorientierten Schürfern in Beschlag genommen.
Entdeckung des Filtrationslagers von Grieze
Auf dem Gelände des Filtrationslagers Grieze und an den Zufahrtsstraßen werden häufig verschiedene Gegenstände ehemaliger Soldaten gefunden. Soldaten, verhaftete Zivilisten, Kriegsgefangene usw. haben sie aus verschiedenen Gründen entsorgt, sowohl um nicht identifiziert zu werden als auch um zu vermeiden, dass ihnen "besondere Aufmerksamkeit" zuteil wird.
Pieta oder "Māmuļa"-Gedenkensemble in Nīkrāce
Pieta oder Mammy ist ein bekanntes Motiv in der europäischen Kultur und Kunst und wurde auch in der Sowjetzeit verwendet.
Steinigung von Panzern
Während der Sowjetzeit war die gesamte Kurzeme-Küste Sperrgebiet. Die Kinder, die in der Nähe der sowjetischen Armeeeinheit in der Gemeinde Targale lebten, darunter auch Ovishi, machten sich einen Spaß daraus, Steine auf Panzer zu werfen.
Kurzeme Küste - geschlossenes Gebiet
Während des Kalten Krieges war der gesamte Küstenstreifen von Kurzeme für die Öffentlichkeit gesperrt - die sowjetischen Grenzsoldaten waren hier die Hauptverantwortlichen, mit Wachposten in bestimmten Abständen und Beobachtungstürmen mit Scheinwerferstationen am Strand. Zivilisten durften sich nur bei Tageslicht am Meer aufhalten.
Vermisste deutsche Soldaten während der Schlacht um Kurland - Karl Grimm
Über die rund 50.000 Soldaten in der Dokumentation der deutschen Heeresgruppe "Nord" gibt es noch keine eindeutigen Angaben. Diese Soldaten werden im Einsatz vermisst. Noch heute versuchen die Angehörigen dieser Soldaten, sowohl dokumentarische als auch physische Spuren ihrer Verwandten und Vorfahren in Kurzeme zu finden. Eine dieser Geschichten handelt von Karl Grimm, einem deutschen Soldaten aus Schwaben (eine historische Region im Südwesten Deutschlands, am Zusammenfluss von Rhein und Donau), der am 27. Oktober 1944 in der Nähe von Landwirtshaus Krūmi vermisst wird (ca. 5 km nach NW von Vaiņode).
Pēteris Čevers - nationaler Partisan und Anführer einer Partisanengruppe
Pēteris Čevera - nationaler Partisan und Kommandeur einer nationalen Partisanengruppe
Jānis Tilibs' Erinnerungen an die Partisaneneinheit "Tēvijas Vanagi"
Jānis Tilibs' Memoiren über die Aktivitäten der Partisaneneinheit "Tevijas Vanagi" in Süd-Kurzeme bis 1950
"Der Krieg ist erst vorbei, wenn der letzte Soldat begraben ist" (Deutscher Soldatenfriedhof Saldus)
Kurzeme wurde am 10. Oktober 1944 zu einem separaten und eigenständigen Schlachtfeld. Etwa 500 000 deutsche Soldaten wurden als eingeschlossen gezählt. Nach den Berichten des Hauptquartiers der 1. Baltischen Front war nur eine "kleine Anstrengung" erforderlich, um die gesamte Ostseeküste vollständig zu befreien. Die Kämpfe in Kurland dauerten jedoch noch sieben Monate an, und Kurland wurde zu einem Symbol für das Ende des Zweiten Weltkriegs.
Während der siebenmonatigen Kämpfe bis Mai 1945 verloren die deutschen Streitkräfte in Kurland 154 108 gefallene, verwundete und vermisste Soldaten. Seit 1997 werden die Soldatenfriedhöfe in der Nähe von Saldus gesichtet und umgebettet. Derzeit sind hier 27 000 Namen gefallener Soldaten zu finden.
Jānis Sūnas‘ Erinnerungen an seine Zeit im Filterlager Grieze
Der Rechtsanwalt Jānis Sūna hat seine Erinnerungen an seine Zeit im Filtrationslager Grieze in seinem autobiografischen Buch veröffentlicht.
Zvardinekas Kindheit im Schatten von Bombenexplosionen - Polygon Summers
Ich verbrachte meine Kindheit in der Nähe des Schießplatzes Zvārde, unter dem Lärm von Explosionen und Düsenjets, konnte aber an manchen Wochenenden trotzdem das Gelände betreten. Nach dem Abzug der Sowjetarmee war das Land übersät mit Bombenkratern und vielen Sprengkörpern, nicht nur aus der Zeit des Schießplatzes, sondern auch aus dem Zweiten Weltkrieg.
Die Kindheit eines Verleumders im Schatten von Bombenexplosionen – Phosphorkapseln
Ich verbrachte meine Kindheit in der Nähe des Schießplatzes Zvārde, umgeben vom Lärm der Explosionen und der Düsenjets. Manchmal durfte man an den Wochenenden trotzdem aufs Gelände. Nach dem Abzug der Sowjetarmee war das Land übersät mit Bombenkratern und vielen Sprengkörpern, nicht nur aus der Zeit des Schießplatzes, sondern auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Besonders gern verbrannten die Jungen Phosphorkapseln …
Sowjetische Flugzeuge bombardieren den Friedhof von Riteli
Der Friedhof von Riteli befand sich mitten im Zielgebiet. Die Einheimischen konnten nur zusehen, wie sie zerstört wurden.
"Der Krieg ist erst vorbei, wenn der letzte Soldat begraben ist" (Priekule Brethrenfriedhof)
Kurzeme entwickelte sich am 10. Oktober 1944 zu einem separaten und isolierten Schlachtfeld. Rund 500.000 deutsche Soldaten galten als eingeschlossen. Berichten des Hauptquartiers der 1. Baltischen Front zufolge war nur „geringer Aufwand“ nötig, um die gesamte Ostseeküste vollständig zu befreien. Die Kämpfe in Kurzeme dauerten jedoch weitere sieben Monate an, und Kurzeme wurde zum Symbol für das Ende des Zweiten Weltkriegs.
Während der siebenmonatigen Kämpfe bis Mai 1945 verlor die deutsche Wehrmacht in Kurland 154.108 Soldaten durch Tod, Verwundung oder Vermisstheit, während die Verluste der Roten Armee bei rund 400.000 Toten, Verwundeten oder Vermissten lagen.
Die Geschichte des abgebauten Denkmals für den Kommandeur der 67. Schützendivision der Roten Armee, N. Dedajew
Nördlich der Südfestung befindet sich der größte Friedhof in Liepāja - der Zentralfriedhof. Im südlichen Teil des Friedhofs befindet sich ein Friedhof der Roten Armee, auf dem sowjetische Soldaten, die in der Nähe von Liepāja gefallen sind, beigesetzt sind, darunter der Kommandeur der 67.
Die wichtige Stellung des Bahnhofs Stende im Eisenbahnnetz von Karalauskas
Die Hauptaufgabe der Feldbahnen im Gebiet der Irbesstraße bestand darin, die Küstenverteidigungsstellungen der deutschen Armee mit Kanonen und Munition zu versorgen.
Erinnerungen des aus Ezera stammenden Jānis Miesnieks an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Ezera
Das Museum für Kultur- und Heimatgeschichte von Ezere, das „Zollhaus“, befindet sich in einem historisch bedeutsamen Gebäude. Am 8. Mai 1945 wurde hier die Kapitulationsurkunde der an der Kurzeme-Front eingekesselten deutschen Wehrmachtseinheiten unterzeichnet.
Der ehemalige Einwohner von Ezer, Jānis Miesnieks (geb. 1930), teilt seine Erinnerungen an die Ereignisse jenes Tages.
Erinnerungen von Kārlis Liberts an den Tag der Kapitulation der deutschen Armee in Ezere
Das Kultur- und Ortsgeschichtliche Archiv „Zollhaus“ von Ezere befindet sich in einem historisch bedeutsamen Gebäude. Am 8. Mai 1945 wurde hier die Kapitulationsurkunde der an der Kurzeme-Front eingekesselten deutschen Heeresgruppe „Kurland“ unterzeichnet.
Der ehemalige Soldat der Roten Armee, Kārlis Liberts, teilt seine Erinnerungen an die Ereignisse jenes Tages.
Aizvīki im Kurländischen Kessel
Im Aizvīķi-Park kann man noch deutlich die Überreste von Bunkern, Schützengräben und Kaponnierwällen aus dem Zweiten Weltkrieg sehen, wo Waffen gelagert wurden. Zu den Waffentypen gehörte das Katjuscha-Raketenwerfersystem.
Erinnerungen an Alfred Leja, einen Dichter
Erinnerungen des ehemaligen Aivzvīgīk Alfrēdas Leja aus dem Buch „Ein endloser Strom von Regen fällt für immer“.
Auch Aizvīķi und seine Bewohner litten sehr unter den Fabriken der Supermächte im Zweiten Weltkrieg.
Alfred Ley schreibt in seinen Memoiren:
Aussage von Jūlijs Bērziņš über die 201. (43. Garde-) Lettische Schützendivision der Roten Armee in den Jahren 1942-1945
Im Herbst 2011 stieß ich auf die Memoiren von Jūlijs Bērziņš (1900–nach 1963), einem in Russland lebenden Letten und ehemaligen Soldaten der 201. (43. Garde-) Lettischen Schützendivision (im Folgenden: 201. Lettische Schützendivision; Division) der Roten Armee. Es handelt sich um einen 189-seitigen, handschriftlichen Bericht in russischer Sprache, verfasst in zwei linierten Notizbüchern, über seine Erlebnisse im Deutsch-Sowjetischen Krieg (1941–1945). Diese Memoiren waren keine Auftragsarbeit.
Die Fähigkeiten des Kommandeurs des 19. Artillerieregiments, Hauptmann Jānis Ozols, während der 3. Schlacht von Kurland
Hauptmann Jānis Ozols war ein lettischer Offizier, Teilnehmer des Zweiten Weltkriegs, Ritter des Drei-Sterne-Ordens, dessen Artilleriedivision während der Dritten Kurlandschlacht einen Frontdurchbruch verhinderte.
Wie Soldaten der Roten Armee die Remte-Kirche niederbrannten
Nach der Kapitulation Deutschlands und der Heeresgruppe Kurland am 8. und 9. Mai 1945 feierten die Sieger ihren Triumph an vielen Orten in Kurland auf unterschiedliche Weise. In Remte wurde die Kirche während dieser Feierlichkeiten niedergebrannt. Die Familie des Glöckners hatte die Kirchenglocke während der gesamten Besatzungszeit auf ihrem Hof aufbewahrt.
Regionalforscher Žanis Skudra erhält 10 Jahre Haft für sein „Tagebuch des besetzten Lettlands“.
Žanis Skudra widmet seine gesamte Freizeit der Lokalgeschichte und verbringt seine Urlaube mit Reisen durch Lettland. So sammelte er Material, fertigte Fotografien an und schuf das „Buch der Tage im besetzten Lettland“, das von der Lettischen Nationalstiftung in Stockholm unter dem Pseudonym Jānis Dzintars herausgegeben wird.
Am 7. Juni 1978 wurde Žani Skudra in Tallinn verhaftet und im November desselben Jahres vom Obersten Gerichtshof in Riga wegen Hochverrats und Spionage zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt.
Mig-27D-Flugzeuge stürzten auf dem Übungsgelände Zvārde und in Lēdurga ab
Anfang 1992 stürzten zwei sowjetische Kampfflugzeuge innerhalb von 40 Minuten unter mysteriösen Umständen auf dem Truppenübungsplatz Zvārde und in Lēdurgās ab.
Russische Militärflugzeuge stürzen auf den Truppenübungsplätzen Ledurga und Zwarde ab.
Anfang 1992 stürzten zwei sowjetische MiG-27 D-Flugzeuge an einem Tag unter mysteriösen Umständen im Abstand von 40 Minuten auf den Truppenübungsplätzen Lēdurga und Zvārde ab.
Aussichtsturm der Küstenwache von Kolka
Versteckt zwischen den letzten Kiefern des Kaps Kolka befindet sich ein Grenzwachturm, in dem sich während der Sowjetzeit ständig ein Grenzposten befand; das kleine Steingebäude daneben ist heute verlassen und verfällt.
Hier traf sich die „Panfilow-Division“ am 9. Mai.
Die „Panfilow-Division“ der Roten Armee befand sich am 9. Mai 1945 in der Nähe von Pampāli. Das Divisionshauptquartier befand sich höchstwahrscheinlich in der Grundschule von Pampāli.
Die Gefangennahme der Kabylen um die Wende von 1945 zu 1946
Eine der markantesten Manifestationen des bewaffneten Widerstands in Kurzeme nach dem Krieg war die Einnahme von Kabile an Weihnachten 1945 und die darauffolgende Schlacht in der Nähe des Hauses Āpuznieki am 1. Januar 1946.
Das Erbe des Legionärs Andrejs Apsītis im Remte-Wald
In den Wäldern Kurzemes werden immer wieder Spuren des Zweiten Weltkriegs gefunden, da Liebhaber von Kriegsrelikten und historischen Antiquitäten die Wälder und Felder der Region häufig mit Metalldetektoren durchkämmen. Anfang 2021 wurden in Remte, einem Ortsteil der Gemeinde Saldus, in einer im Wald vergrabenen Munitionskiste verschiedene Dokumente entdeckt, die die Zugehörigkeit zur 19. Division der Lettischen Legion bestätigten, sowie persönliche Gegenstände eines Soldaten. Sie hatten 76 Jahre lang im Boden gelegen.
Doppelagent der UdSSR – Edvīns Ozoliņš mit dem Spitznamen „Pilot“
Die Geheimdienst- und Spionageabwehrkriege des Kalten Krieges zwischen dem Westen und der UdSSR umfassten Agenten beider Seiten sowie Doppelagenten. Seit den 1920er Jahren hatten die sowjetischen Sicherheitsdienste ein völlig neues Mittel zum Schutz des Regimes entwickelt: Desinformation. Ein Begriff, der im Westen bis dahin unbekannt war.
Die Rolle des ehemaligen Legionsleutnants – Tscheka-Agenten Arvīds Gailītis bei der Liquidierung der Pēteris Čevers-Gruppe
Hauptmann Pēteris Čevers und sieben weitere Partisanen wurden am 1. November 1950 im Engure-Waldmassiv gefangen genommen. Dort befand sich zufällig eine Schein-Partisanengruppe unter der Führung des ehemaligen Legionsleutnants Arvīds Gailītis (Spitzname des Agentenkämpfers: „Grosbergs“) in der Nähe. Ihr gehörten Angehörige der Lettischen SSR-Volksmiliz VDM und Agentenkämpfer an, die sich als „Waldbrüder“ ausgaben.
Die Aktivitäten und die Zerstörungsgeschichte der Peter-Cheevers-Gruppe
P. Čevers versammelte ehemalige Offiziere der Legion um sich und nahm auch Einheimische aus Kurzeme in die Gruppe auf. Sie alle entschieden sich, der Idee eines freien und unabhängigen lettischen Staates treu zu bleiben, anstatt sich einer fremden Besatzungsmacht zu unterwerfen. Čevers' Gruppe operierte im Gebiet der Pfarreien Vandzene, Upesgrīva und Okte im Bezirk Talsi und versuchte, Frontalzusammenstöße mit Tscheka-Truppen oder Kämpfern der Zerstörerbataillone zu vermeiden.
Außergerichtliche Erschießung von Zivilisten im „Blauen Wunder“ von Liepāja
Die außergerichtlichen Tötungen auf lettischem Gebiet während des Krieges, Ende Juni und Anfang Juli 1941, waren die letzte Manifestation von Repression und Gewalt in der ersten Phase der kommunistischen Besatzung, die mit dem Einmarsch nationalsozialistischer deutscher Truppen in das gesamte Gebiet Lettlands endete.
Der Grund für die Erschießungen war entsetzlich und tragisch: Die Gefangenen konnten nicht mehr nach Russland überführt werden, doch durfte man sie nicht am Leben lassen. Infolgedessen kam es während des Krieges auch in Liepāja zu außergerichtlichen Erschießungen von Einwohnern, ähnlich wie im Zentralgefängnis Riga, im Gefängnis Valmiera, bei den Milizen in Valka und Rēzekne sowie in Greizā kalns bei Ludza. In Liepāja wurde dieses Verbrechen der sowjetischen Besatzungsmacht im sogenannten „Blauen Wunder“ verübt – im Gebäude der Miliz in der Republikas-Straße 19.
Ehemalige Holzverarbeitungsanlage „Vulkāns“
Eine leistungsstarke Fabrik mit einer reichen Geschichte, die bis ins Jahr 1878 zurückreicht.
Raketenstützpunkt Tisza
Der Raketenstützpunkt Tisza war einer der geheimen strategischen Militärstützpunkte der UdSSR, auf dem ballistische Raketen vom Typ R12 stationiert waren.
Hugo Legzdziņš, Kapitän von Lettlands erstem U-Boot „Ronis“
Kapitän des ersten lettischen U-Boots „Ronis“, Hugo Legzdziņš, Verhaftung der „Ronis“-Besatzung
Der Turm der Dreifaltigkeitskirche in Jelgava in der Akadēmijas-Straße 1, wo Egons Užkurelis und Jānis Ģēģeris 1952 eine selbstgemachte lettische Flagge hissten
Am 12. Oktober 1952 hängte Egons Užkurelis, damals erst 14 Jahre alt, zusammen mit seinem ein Jahr älteren Freund Jānis Ģēģeris eine selbstgemachte lettische Nationalflagge am Turm der Dreifaltigkeitskirche in Jelgava auf, die im sowjetisch-deutschen Krieg im Juli/August 1944 zerstört worden war.














































































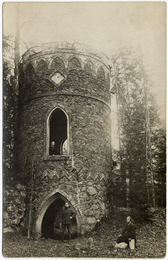












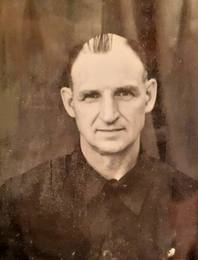




















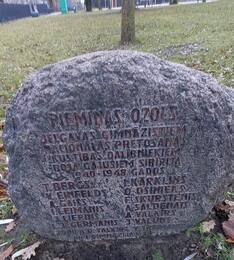






































Die sowjetische Besatzung dauerte bis 1991. Guten Tag. Warum 1991, wenn die Armee 1993 die Mülldeponie verließ?