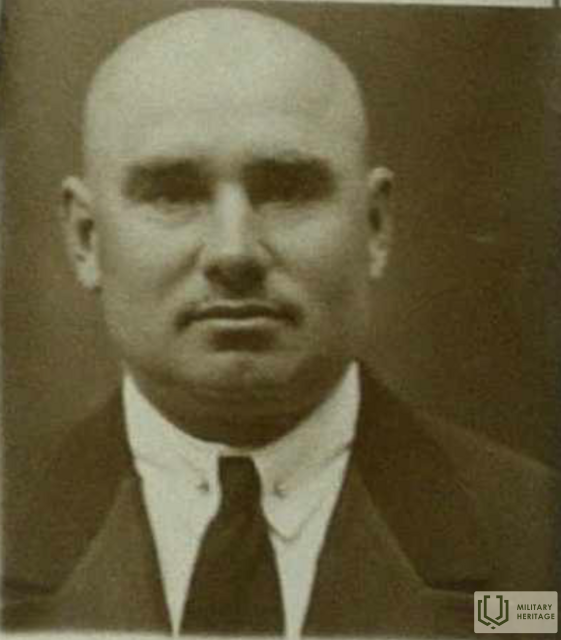Außergerichtliche Erschießung von Zivilisten im „Blauen Wunder“ von Liepāja

Die außergerichtlichen Tötungen auf lettischem Gebiet während des Krieges, Ende Juni und Anfang Juli 1941, waren die letzte Manifestation von Repression und Gewalt in der ersten Phase der kommunistischen Besatzung, die mit dem Einmarsch nationalsozialistischer deutscher Truppen in das gesamte Gebiet Lettlands endete.
Der Grund für die Erschießungen war entsetzlich und tragisch: Die Gefangenen konnten nicht mehr nach Russland überführt werden, doch durfte man sie nicht am Leben lassen. Infolgedessen kam es während des Krieges auch in Liepāja zu außergerichtlichen Erschießungen von Einwohnern, ähnlich wie im Zentralgefängnis Riga, im Gefängnis Valmiera, bei den Milizen in Valka und Rēzekne sowie in Greizā kalns bei Ludza. In Liepāja wurde dieses Verbrechen der sowjetischen Besatzungsmacht im sogenannten „Blauen Wunder“ verübt – im Gebäude der Miliz in der Republikas-Straße 19.
Die Gründe für diese Tragödie liegen in der paranoiden Weltanschauung des kommunistischen Besatzungsregimes. Von Beginn seines Bestehens im Jahr 1917 an gehörte neben der „Weltrevolution“ die ständige Suche nach und die Neutralisierung von äußeren und inneren Feinden zu seinen wichtigsten Zielen.
Die außergerichtlichen Tötungen während des Krieges, Ende Juni und Anfang Juli 1941, waren die letzte Manifestation von Repression und Gewalt in der ersten Phase der kommunistischen Besatzung, die mit dem Einmarsch nationalsozialistischer deutscher Truppen in das gesamte Gebiet Lettlands endete.
Diese Verbrechen wurden von Tscheka-Offizieren, Milizionären, Arbeitergardisten, Aktivisten der Kommunistischen Partei und des Komsomol begangen.
Nach den bisher vorliegenden Informationen begannen die Verhaftungen von Zivilisten in Liepāja während des Krieges am 23. Juni 1941. Die Gesamtzahl der Verhafteten ist unbekannt, aber es ist bekannt, dass 18 Menschen von der Miliz von Liepāja erschossen wurden, mindestens fünf jedoch überlebten und entkamen.
Der Grund für die Erschießung war entsetzlich und tragisch: Die Gefangenen konnten nicht mehr nach Russland überführt werden, durften aber nicht am Leben gelassen werden. Infolgedessen kam es während des Krieges auch in Liepāja zu außergerichtlichen Erschießungen von Einwohnern, ähnlich wie im Zentralgefängnis Riga, im Gefängnis Valmiera, in den Polizeistationen Valka und Rēzekne sowie in Greizā kalns bei Ludza. Das erwähnte Verbrechen ereignete sich im „Blauen Wunder“ – dem Polizeigebäude in Liepāja in der Republikas-Straße 19.
Die Namen von sechzehn Personen, die von der Polizei in Liepāja erschossen wurden, sind derzeit bekannt:
1. Bezalel Geshaya–Shloma d. Biļeckis (1879). Jude. Lebte in Liepāja, Graudu-Straße 6. Er besaß wahrscheinlich ein Geschäft in der Graudu-Straße 50.
2. Andrejs Brekteris (1872). Mechaniker. Die Quellen nennen zwei mögliche Adressen: Lāču-Straße 31 oder T. Breikša-Straße 32. A. Brekteris wurde 1938 mit dem Verdienstkreuz ausgezeichnet. Er war einige Zeit Leiter der lutherischen Gemeinde in Jaunliepāja.
3. Krišs Viļa d. Hintenbergs (1914). Arbeiter in der Schuhfabrik „Kopsolis“. Lebte in der Dārzu-Straße 49.
4. Alfred Roberta d. Holcmanis (1914). Geboren in der Gemeinde Purmsāti. Büroangestellter in der Drahtfabrik Liepāja („Roter Metallurg“). Wachmann. Fußballspieler. Wohnhaft in der F. Brīvzemnieka Straße 10–3. Verhaftet am 23. Juni 1941.
5. Francisco d. Jacino (1905). Katholischer Deutscher. Absolvent der Elektrotechnik an der Technischen Universität Liepāja. Ingenieur. Wohnhaft in der Kr. Valdemāra Straße 18.
6. Melanija Jacino (1884). Deutscher Katholik. Mutter von F. Jacino. Lebte in Kr. Valdemāra-Straße 18.
7. Alberts Jāņa d. Kalve (Winčels) (1907). Geboren in Moskau. Ruderer, Mitglied der „Universitātes Sportas“. Im April 1940 änderte er seinen Nachnamen von „Winčels“ in „Kalve“. Stellvertretender Staatsanwalt am Bezirksgericht Liepāja. Verheiratet mit Biruta Winčels (geb. Bruņenieci). Lebte in Liepāja, Kr. Barona Street 19. Verhaftet am 23. Juni 1941.
8. Jāzeps Keiselis (1886). Geboren im Bezirk Rēzekne. Katholisch. Bis zur Besetzung Lettlands war er Polizist, danach Arbeiter. Wohnte in der Ukstiņa-Straße 19.
9. Francis-Einārs Eduarda d. Rozenholms (1892). Vermutlich finnischer Staatsangehörigkeit. Schmied der Aktiengesellschaft „Pluto“. 1940/41 gehörte die Fabrik zum Industrieunternehmen „Metal“, zu dem auch das Wagenwerk Liepāja und das Maschinenbauwerk „Standarts“ zählten. Im Mai oder Juni 1941 wurde er als Stachanow-Schmied anerkannt, da er „durch die Rationalisierung der Hammerpressarbeit die Produktivität um 150 % gesteigert hatte“. Er wohnte in der Rainastraße 52. Am 23. Juni 1941 wurde er verhaftet.
10. Līze Miķeļa m. Rošteina (geb. Strazdiņa) (1885). Bis zur Besetzung Lettlands war sie Inhaberin eines Ladens in der Bāriņu-Straße 21. Sie lebte dort. Schwester von Kate und Fričis Strazdiņas sowie Schwester von Rūdolfs Strazdiņas‘ Vater.
11. Kate Miķeļa m. Strazdiņš (1883). Verkäuferin. Wohnte in Liepāja, T. Breikša-Straße 5. Schwester von Līze Rošteina und Fričis Strazdiņš sowie Schwester von Rūdolfs Strazdiņšs Vater.
12. Fricis Miķeļa d. Strazdiņš (1880). Verkäufer. Wohnte in der Sienu-Straße 11. Bruder von Līze Rošteina und Kate Strazdiņš sowie Bruder von Rūdolfs Strazdiņšs Vater.
13. Rūdolfs Kristapa, geborene Strazdiņš (1912). Bauer. Lebte in „Kugrā“ der Gemeinde Durbe. Sohn von Līze Rošteina, Bruder von Kate und Fričis Strazdiņš.
14. August Otto d. Tauriņš (1910). Baptist. Bibliothekarin in Liepāja. Wohnte im Bibliothekshaus in der Zivju-Straße 7.
15. Eugene Karla d. Vilamovskis (1880). Der schwere Holzfäller. Wohnte in der Dzintara-Straße 52.
16. Jānis Viļa d. Vibrants (1876). Rentner. Wohnte in Liepāja, F. Brīvzemnieka Straße 47.
Leider sind die Identitäten der beiden Getöteten weiterhin unklar. Der Anwalt Linards Muciņš deutet in seinem Bericht über die Tragödie im „Blauen Wunder“ an, dass auch Ernests Briķis zu den Erschossenen gehörte.
Die Schießerei ereignete sich am frühen Morgen des 27. Juni, einem Freitag. Die Milizionäre begannen, die Gefangenen der Reihe nach aus ihren Zellen zu rufen. Bedauerlicherweise folgte auf den Fund der Schussopfer keine gerichtsmedizinische Untersuchung und keine Erstellung entsprechender Dokumente.
Die Informationen zu den Bestattungsorten und -zeiten der im „Blauen Wunder“ Erschossenen sind unvollständig. Bislang konnten nur die Bestattungsorte von zehn Personen identifiziert werden.
Obwohl unvollständig, sind auch Informationen über sechs Personen erhalten geblieben, die an der Erschießung der Gefangenen beteiligt waren und für das Verbrechen, das sie während der deutschen Besatzung begangen hatten, erschossen wurden.
Inese Dreimane, Historikerin, Schriftstellerin, Publikation „Außergerichtliche Erschießung von Zivilisten durch die Miliz von Liepāja oder das sogenannte ‚Blaue Wunder‘ Ende Juni 1941“
https://www.delfi.lv/news/versijas/civiliedzivotaju-beztiesas-nosausana-liepajas-milicija-jeb-ta-sauktaja-zilaja-brinuma-1941-gada-junija-beigas.d?id=55323776
Zugehörige Zeitleiste
Zugehörige Objekte
Polizeigebäude von Liepaja oder "Blaues Wunder"
In Liepāja befand sich die Miliz, eine Institution des kommunistischen Besatzungsregimes, in einem Gebäude in der Republikas-Straße 19, das die Bevölkerung Liepājas seit seiner Errichtung zu Beginn des 20. Jahrhunderts als „Blaues Wunder“ bezeichnete. Das Hauptquartier der Tscheka hingegen lag in der Toma-Straße 19. Kurz nach der Besetzung erhielt es den Beinamen „Rotes Wunder“.
Im Zuge der bisherigen Ermittlungen zu den Verbrechen des kommunistischen Regimes wurde festgestellt, dass weder im Gebäude der Liepāja-Tscheka (dem sogenannten „Roten Wunder“) noch im Gefängnis selbst Hinrichtungen oder außergerichtliche Hinrichtungen stattfanden. Alle Häftlinge, die sich aufgrund des Ausbruchs der Kampfhandlungen auf lettischem Gebiet ab dem 23. Juni 1941 dort befanden, wurden in Gefängnisse in Russland verlegt. Dies betraf sowohl Häftlinge, die wegen sogenannter „politischer“ Verbrechen verhaftet worden waren, als auch Straftäter, unabhängig davon, ob gegen sie ermittelt wurde oder sie bereits verurteilt waren.
Die Überführung der Gefangenen erfolgte gemäß Erlass Nr. 2455/M des Volkskommissars für Staatssicherheit der UdSSR, Wsewolod Merkulow, vom 23. Juni 1941, der an die Chefs des NKGB der Lettischen SSR, der Estnischen SSR und mehrerer Regionen der Ukrainischen SSR gerichtet war. Der Grund für die Erschießungen war entsetzlich und tragisch: Die Gefangenen konnten nicht mehr nach Russland überführt werden, durften aber nicht am Leben gelassen werden. Infolgedessen kam es während des Krieges auch in Liepāja zu außergerichtlichen Erschießungen von Einwohnern, ähnlich wie im Zentralgefängnis Riga, im Gefängnis Valmiera, bei den Milizlagern Valka und Rēzekne sowie in Greizā kalns bei Ludza. Das erwähnte Verbrechen ereignete sich im „Blauen Wunder“ – dem Milizgebäude in Liepāja in der Republikas-Straße 19.