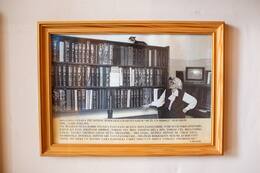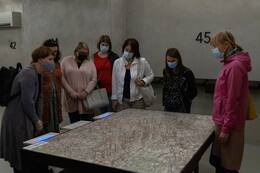Repression
II Zweiter Weltkrieg, IV Sowjetische Okkupation
Represijos – tam tikrų asmenų ir gyventojų kategorijų persekiojimas, priespauda ir ribojimas, naudojamas valdžios. Smurtinės represijos prieš Latvijos gyventojus buvo būdingos tiek SSRS, tiek nacistinės Vokietijos okupaciniams režimams.
Siekdama išvengti pasipriešinimo ir nepasitenkinimo nauju režimu, sovietų okupacinė valdžia jau 1940 metų vasarą pradėjo vykdyti sistemingas represijas prieš Latvijos piliečius, kurias vykdė SSRS NKVD (vidaus reikalų liaudies komisariato) represinės organizacijos ir pagal jų modelį vietoje sukurtos struktūros. Dėl politinių priežasčių 1940–1941 m. 2011 metais buvo suimta daugiau nei 7000 Latvijos gyventojų, neskaičiuojant ištremtųjų. Didžiausia represinė akcija – 1941 metų birželio 14 dienos trėmimas, kurio metu gyvuliniuose vagonuose į SSRS iš Latvijos buvo ištremti 15 424 gyventojai. Suimtieji buvo išsiųsti į GULAGo darbo stovyklas, o administracine tvarka ištremtieji buvo apgyvendinti Sibiro kolūkiuose.
1941 metų vasarą Latvijos teritorija pateko į nacistinės Vokietijos valdžią, kurios okupacinis režimas buvo ne mažiau žiaurus nei sovietinis. Didžiausias nacistinės Vokietijos nusikaltimas Latvijos teritorijoje buvo genocidas prieš žydus arba holokaustas. Dėl Hitlerio rasistinės ideologijos buvo sistemingai naikinama beveik visa kelis šimtus metų gyvavusi Latvijos žydų bendruomenė – apie 70 000 žydų ir dar 20 000 žydų iš kitų Rytų Europos teritorijų. Šaudymo kampanijos prieš žydus dažniausiai buvo vykdomos jau 1941 m. Vokiečių okupacinis režimas taikėsi ir į režimo politinius oponentus bei sovietų aktyvistus, kurie Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karo pradžioje nespėjo evakuotis į Rusiją.
Nuo 1944 m. Latvijos teritorijoje įsitvirtino ir atkurta sovietinė okupacinė valdžia. Antroji sovietų okupacija atnešė naujų politinių represijų. Pirmaisiais pokario metais Latvijoje veikė ginkluotas tautinio pasipriešinimo judėjimas, arba nacionaliniai partizanai. Jų tikslas buvo atkurti Latvijos nepriklausomybę. 20 a Ketvirtajame dešimtmetyje buvo masiškai areštuojami šių pasipriešinimo judėjimų nariai ir jų rėmėjai, taip pat buvo baudžiami tie Latvijos gyventojai, kurie savo noru ar prievarta bendradarbiavo su vokiečių okupaciniu režimu, taip pat kitos gyventojų grupės. 1944-1945 m. 2018 metais buvo suimta apie 38 000 žmonių. Didžiausia sovietų okupacijos metais po Antrojo pasaulinio karo vykdyta baudžiamoji akcija buvo 1949 m. kovo 25 d. trėmimas. Jo metu iš Latvijos į Sibirą ir kitas atokias SSRS vietoves buvo ištremti 42 195 Latvijos gyventojai, daugiausia moterys ir vaikai. Skaičiuojama, kad pirmosios sovietų okupacijos metu 1940-1941 m. 1945–1953 metais nuo sovietų represijų Latvijoje nukentėjo arba žuvo 140–190 000 žmonių.
Baiminantis sovietinio okupacinio režimo sugrįžimo, 1944 metais taip pat prasidėjo pabėgėlių judėjimas iš Latvijos į Vakarus jūrų ir sausumos keliais.
Weitere Informationsquellen
Totalitarinių okupacinių režimų represijos prieš Latvijos gyventojus. 1940-1953 m. Latvijos nacionalinis istorijos muziejus: http://lnvm.lv/?page_id=3976
Totalitariniai okupaciniai režimai Latvijoje 1940-1964 m. Latvijos istorikų komisijos tyrimas. Latvijos istorikų komisijos straipsniai. 13 tomas. Ryga, 2004. https://www.president.lv/storage/kcfinder/files/item_1618_Vesturnieku_komisijas_raksti_13_sejums.pdf
Связанная хронология
Связанные объекты
Jüdischer Friedhof Varaklani – ein Denkmal für die Opfer des deutsch-faschistischen Terrors
Jüdischer Friedhof Varakļāni, am Ende der Kapsētas-Straße.
Auf dem jüdischen Friedhof von Varakļāni wurden nach dem Krieg zwei Denkmäler von überlebenden Verwandten und Verwandten errichtet.
Einer von ihnen befindet sich in der Nähe des Friedhofszauns, wo die Massenvernichtung von Juden stattfand. Die Inschrift darauf auf Russisch und Jiddisch lautet: "Wir werden für immer mit unseren Eltern, Brüdern und Schwestern trauern, die 1941 durch die Hand der Faschisten starben." Das zweite Denkmal befindet sich auf dem Friedhof; An der Stelle, wo die getöteten Juden später umgebettet wurden, befindet sich außerdem eine Inschrift in jiddischer und russischer Sprache: „Ewiges Gedenken an die Opfer des deutsch-faschistischen Terrors – die am 4. August 1941 brutal ermordeten Juden von Varakļāni“.
Nazideutsche Truppen marschierten 1941 in Varaklani ein. Anfang Juli und von den ersten Tagen an begannen die Belagerung und vereinzelte Ermordung von Juden. In der Nähe des jüdischen Friedhofs wurde ein bedingtes Ghetto eingerichtet, in das alle Juden umziehen mussten. Am 4. August erschoss eine deutsche SD-Einheit (das "Arāja-Team") mit Hilfe lokaler Selbstverteidigungskräfte auf dem Gelände des jüdischen Friedhofs praktisch alle Juden in Varakļāni (etwa 540 Personen).
Jedes Jahr am ersten Sonntag im August findet auf dem jüdischen Friedhof von Varakļāni eine Gedenkveranstaltung statt, die den in Varakļāni getöteten Juden gewidmet ist.
Melānija-Vanaga-Museum und sibirische Erdhütte
Das Melānija-Vanaga-Museum ist in der einstigen Dorfschule von Amata (Landkreis Cēsis) untergebracht. Das Museum präsentiert Materialien über das Leben, die dichterische Tätigkeit, die Familiengeschichte und das Lebensschicksal der Schriftstellerin und Kulturhistorikerin Melānija Vanaga: Videoaufnahmen über Sibirien und die dorthin deportierten Letten sowie die nachempfundene sibirische Erdhütte sind wie eine imaginäre Reise in den Verbannungsort der Schriftstellerin - Tjuchtet im Gebiet Krasnojarsk. Aussehen und Einrichtung der Behausung vermitteln einen lebendigen Eindruck vom harten Alltag in der Fremde. Die Erdhütte birgt seltene betagte Gegenstände aus dem Museum in Tjuchtet: ein Gefäß aus Birkenrinde (genannt „Tujesok“), einen Tonkrug („Krinka“ genannt) und eine Petroleumlampe. Das Museum verfügt über Videoaufzeichnungen von Interviews mit politisch Verfolgten aus der Region und achtzehn Figuren aus Melānija Vanagas autobiografischem Buch „Veļupes krastā“. Die virtuelle Ausstellung des Museums „SEI DU SELBST!“ (http://esipats.lv) schildert die Erlebnisse von fünf deportierten Kindern und ihren Eltern, die von den sowjetischen Behörden zu Unrecht des „Vaterlandsverrates“ beschuldigt wurden.
Gedenkstätte Salaspils
Die Mahn- und Gedenkstätte Salaspils befindet sich in der Gemeinde Salaspils, 1,2 km von der Fernstraße A6 Riga-Daugavpils entfernt. Sie wurde 1967 an der Stelle des Konzentrationslagers Kurtenhof eröffnet. Es handelt sich hier um einen von Mythen und Halbwahrheiten umwobenen Ort, der von der sowjetischen Propaganda ausgenutzt wurde: ein Beispiel in Lettland für die Nazi-Verbrechen und die kommunistische Ideologie. Kurtenhof/Salaspils war ein Straflager („Arbeitserziehungslager“) innerhalb des deutschen Strafvollzugssystems. Es bestanden Ähnlichkeiten zu klassischen Konzentrationslagern. Das Lager wurde als „erweitertes Polizeigefängnis“ geführt und aufgebaut, um die Rigaer Gefängnisse zu entlasten. Unterschiedliche Gruppen von Menschen waren hier inhaftiert: Juden, sowjetische Kriegsgefangene, Arbeitsverweigerer, politische Gefangene, Kriminelle, Prostituierte, Mitglieder der lettischen Widerstandsbewegung, bestrafte baltische Soldaten, die zum deutschen Armee- oder Polizeidienst herangezogen waren und andere. Bis zu 2200 Häftlinge waren gleichzeitig in dem Lager untergebracht. Die Haupttodesursachen (ca. 2000) waren Unterernährung, die schweren Arbeitsbedingungen, körperliche Züchtigung und Krankheiten.
Denkmal für die Opfer des kommunistischen Völkermords
Dieses Denkmal befindet sich auf dem Friedhof Pilistvere.
Die Vorarbeiten für das Denkmal begannen 1988, als sich 300 Menschen für die Sache einsetzten. Die gemeinsame Anstrengung der Freiwilligen dauert bis heute an, wobei jedes Jahr Verbesserungen an der Gedenkstätte vorgenommen werden. Die Idee für das Denkmal kam vom Freiheitskämpfer Lagle Parek.
In seiner Mitte liegt ein Steinhaufen, der von Orten in ganz Estland, aus Sibirien und noch weiter entfernt von estnischen Auswanderern mitgebracht wurde. Der Steinhaufen wird von einem großen Kreuz gekrönt. Der Fuß des Kreuzes ist ein symbolisches Grab, zu dem die Esten Steine bringen, um ihrer nach Sibirien deportierten Angehörigen zu gedenken.
Der Steinhaufen ist von Felsbrocken umgeben, einer für jeden Bezirk, entworfen von Aate-Heli Õun und in Phasen gesetzt.
In der Nähe des Denkmals befinden sich Gedenksteine für die Opfer der Verstrahlung von Tschernobyl, für die Waldbrüder, für die Wehrpflichtigen in den Arbeitskolonnen des NKWD, für estnische Freiwillige in der finnischen Armee und für Freiheitskämpfer. Diese wurden alle von Endel Palmiste entworfen.
Neben dem Steinhaufen wurde in der Nähe des Denkmals ein Hain mit mehr als 2000 Gedenkbäumen gepflanzt. Der Hain wurde vom renommierten Landschaftsarchitekten Andres Levald entworfen.
Das historische Pfarrhaus Pilistvere, das als Hauptgebäude der Gedenkstätte dient, beherbergt ein Archiv und eine Ausstellung des Estnischen Geschichtsmuseums über die Besetzung Estlands.
Sommerlager der lettischen Armee in Litene
Das Sommerlager der lettischen Armee in Litene befindet sich in einem Waldgebiet in der Gemeinde Litene, dicht am Fluss Pededze. Die Geschichte des Lagers Litene begann 1935, als die Division Latgale der lettischen Armee hier den Aufbau eine Sommerlager in Angriff nahm. Von Mai bis in den Herbst absolvierten in Litene tausende Soldaten Ausbildungs- und Schießtrainingsprogramme. Im Sommer 1941 wurden Offiziere der lettischen Armee von Einheiten der Roten Armee und des NKWD (Vorläufer des KGB) im Sommerlager Litene festgehalten und interniert. Ein Teil der Offiziere wurde in Litene erschossen, andere nach Sibirien deportiert. Am 14. Juni 1941 wurden in den Lagern Litene und Ostrovieši (etwa 10 km von Litene entfernt) mindestens 430 Offiziere verhaftet und nach Sibirien deportiert. Das einzige vom damaligen Lager noch erhaltene Gebäude ist das Lebensmittellager. Von den anderen Bauten sind nur noch Fundamente erkennbar. Eine Aussichtsplattform über der eine lettische Flagge weht, Bänke und eine Lagerfeuerstelle wurden hier inzwischen geschaffen. Mit Unterstützung des Verteidigungsministeriums und der nationalen Streitkräfte wurde ein nicht mehr einsatzfähiges Geschütz aufgestellt. Auch Informationstafeln wurden errichtet. Zum Andenken an die Vorgänge im Sommerlager wurde auf dem Friedhof von Litene eine „Mauer des Schmerzes“ errichtet. Auf YouTube ist im Kanal der lettischen Armee („Latvijas armija“) ein Kurzfilm unter dem lettischen Titel „Litene - Latvijas armijas Katiņa“ (Litene – Das Katyn der lettischen Armee) abrufbar.
Valu mälestusmüür
Artrodas Litene kalmistu.
14. juunil 2001 avati Litene kalmistul arhitektide Dina Grūbe, Benita ja Dainis Bērziņši, kiviraidurite Ivars Feldbergsi ja Sandra Skribnovskise loodud mälestusmärk “Valu müür”, mis sümboliseerib 1941. aastal hukkunud sõdurite puhkepaika. 1988. aasta oktoobris leiti Litene vallas Sita Sililas endise Läti armee suvelaagri territooriumilt 1941. aasta juunis Nõukogude armee poolt tapetud 11 ohvitseri põrm. Kuigi neid ei suudetud tuvastada, maeti 2. detsembril 1989. aastal Gulbene Evangeelses Luterlikus kirikus toimunud pühitsemise jumalateenistusel Litene kalmistule pidulikult ümber.
11 valget risti, mälestustahvel ja infostendid.
Memorial "White cross" in Stopiņi
Located in the forest 50 m from the highway V36, in the section from the village of Jugla paper factory to the highway P4.
Between February 3 and March 25, 1941, the remains of 23 people were described in four pits at the site. The victims were shot in a check building in Riga. The exhumation took place on April 27, 1944. At that time, 14 burials were identified, today, as a result of research, all those buried in this place have been identified.
The White Cross was erected at the site on July 12, 1991, as a memorial to the victims of the communist occupation. The White Cross was made and installed by the folk fronts and residents of Stopiņi County. In 1998, a memorial stone made by the sculptor Uldis Stergs with the inscription "Victims of the Russian Empire in 1941" was erected near the White Cross.
Buried here: Jānis Bergmanis (1900-1941), Alberts Bļodnieks (1904-1941), Kārlis Goppers (1876-1941), Arveds Laane (1916-1941), Ernests Ošs-Oše (1882-1941), Antons Pacevičs (1901 -1941), Joseph Poseiko (1897-1941), Arnold Smala (1912-1941), Joseph Stoller (1903-1941), Valfrid Vanx (1888-1941), Zenon Vyaches (1904-1941), Viktor Kopilov (1904-1941) ), Kārlis Prauls (1895-1941), Artūrs Salnājs (1904-1941), Jevgenijs Simonovs (1896-1941), Eduards-Verners Anerauds (1897-1941), Ephraim Gorons (1910-1941), Pēteris Ļaksa-Timinskis (1913 -1941), Pēteris Melbārdis (1892-1941), Israel Paļickis (1911-1941), Jānis Priedītis (1897-1941), Jānis-Arnolds Stālmanis (1913-1941), Aleksandrs Veinbergs (1884-1941).
Museum of the Occupation of Latvia
The museum exhibits the history of Latvia from 1940 to 1991, under the occupation of Nazi Germany and the Soviet Union. ‘House of the Future’ is a reconstruction and expansion project of the Occupation Museum designed by the well-known American Latvian architect Gunārs Birkerts as well as the new exhibit of the museum. The exhibit ‘History of Cheka in Latvia’ was created by the Occupation Museum and it is located in the ‘Corner House’, which is the former USSR State Security Committee (KGB) building. Latvian Occupation Museum was founded in 1993. It tells the long-hidden story of the fate of the Latvian state, nation and land under the occupation of two foreign totalitarian powers from 1940 to 1991. At the end of 2020 the museum had more than 70,000 different historical items (documents, photographs, written, oral and material evidence, objects and memorabilia). Museum specialists have recorded more than 2,400 video testimonials, making it one of the largest collections on occupation in Europe. The events that unfolded in Latvia, Lithuania and Estonia clearly show us what the nations had to endure under the two totalitarian regimes.
Exhibition in the KGB Building "History of KGB Operations in Latvia"
The former USSR State Security Committee (commonly known as Cheka) building is open for visitors. Here chekists imprisoned, interrogated and murdered Latvian citizens who were considered opponents by the occupation regime. There is also an exhibit from the Latvian Occupation Museum on the activities of Cheka in Latvia. Guided tours of the prison cells, corridors, basement and courtyard are available. The house was built in 1911 and it is one of the most beautiful buildings in Riga. Called the ‘Corner House’ by the people, it was the scariest symbol of the Soviet occupation regime in Latvia, and also one of the pillars of power of the USSR. Cheka operated from the Corner House during the occupation from 1940 to 1941 and then again from 1945 to 1991. Tens of thousands of Latvians were affected by direct political persecution. The fight against enemies of Soviet rule continued also after World War II. Cheka’s approach towards its operation slightly changed after Stalin’s death. Physical torture was replaced by psychological terror. The majority of Cheka agents were Latvians (52%). Russians were the second largest group – 23.7%. 60.3% of the agents were not members of the Communist Party. 26.9% of the agents had higher education. The system was designed in a way to involve local people and thus have greater control over the society. Staff documents and service records are located in Russia. And these materials have not been made available to Latvian authorities and researchers.
Broņislava Martuževa poetry barn
The Broņislava Martuževa Museum is situated on the site of the poet’s childhood home in Indrāni parish, Madona municipality. The museum’s exhibit is located in a renovated barn featuring voice and video evidence from the National Resistance Movement and the work of the poet in publishing an underground magazine, as well as composing poetry and songs for national partisans. Broņislava Martuževa was involved with the resistance movement since its inception. Lazdiņas, Martuževa’s home which has not survived, also served as a place of refuge for Pēteris Supe, Head of the Latvian National Partisan Association, and his comrades-in-arms. The poet spent five years hiding in the basement of her home, meeting with partisans, writing poetry (including work dedicated to partisans Pēteris Supe, Vilis Toms, Smilga Group, Laivenieks, Salns, Celmiņš, Bruno Dundurs and others), as well as writing songs and teaching them to partisans. Now, her songs are sung by the ‘Baltie lāči’ group (literally: ‘White Bears’). In 1950, the ‘Dzimtene’ magazine (literally: ‘Motherland’) was published underground together with Vilis Toms. The poet transcribed 11 issues of the magazine, 10 copies each, by hand. The poet, her brother, sister, mother and Vilis Toms were arrested in 1951. Bronislava Martuževa returned from Siberia in 1956. Recognised locally and nationally, the poetry barn is visited by both local residents and guests of the municipality. Learning about the poet’s life gives you the opportunity to discover the fate of Latvia.
Historical Exposition “The Burning Conscience”
The historical exhibit ‘Fire of Conscience’ is located in Cēsis, near the Cēsis Castle Square. Established in a Soviet-era temporary detention facility, it tells about the occupation of Latvia and reveals surprising and heroic stories of resistance from individuals. The yard features a memorial wall with the names of 643 residents of the former Cēsis district who died in Soviet repressions, including national partisans deported in 1941 and 1949 and those shot and sentenced to death. The exhibit’s timeline encourages visitors to study the course of the occupation of Latvia from 1939 to 1957. Arranged by topics, quotes from local newspapers offer a comparison of the political propaganda of the two occupation regimes. The six cells for temporary detention have survived to the present day in their original form from 1940 to 1941 and the post-war years. Here, the residents of Cēsis district, detained for various anti-Soviet activities, including national partisans, their supporters, young people who distributed anti-Soviet leaflets and other ‘traitors of the motherland’, were held for several days during the initial investigation and interrogation before being sent to the main KGB Building in Riga. Everything here is real: cells with iron doors, built-in ‘kormushkas’ (small openings for providing food), plank beds, a latrine for detainees, a small kitchen with an oven, as well as typical Soviet-era oil paint on the walls. In 2019, the exhibit was ranked third in the national design competition, the Latvian Design of the Year Award.
Permanent exposition of local history of Vaidava parish
Located in Vaidava Culture and Craft Center.
There is an exposition dedicated to the memory of the deportations of 1949, as well as the participation of the people of Riga in the January 1991 barricades in Riga. Evidence of world wars (mainly printed materials) can also be seen in the exhibition.
Natural and historical objects, manors, history of education, culture, notable people, materials of the collective farm time, household items, banknotes, newspapers, magazines about Vaidava parish.
Memorial to the Victims of Communist Terror for the Repressed in Jaunrauna Parish
Located in "Baižēni", Priekuli parish
A memorial place for the repressed was created in the place of the ruins of the barn of the "Baižēni" house, where on the night of March 25, 1949, 40 residents of Jaunrauna parish were kept to take their way to Lode railway station and Siberia in the morning.
The repressed included children under 1 year of age and 87-year-olds.
The names of those who were shot or died in exile are also written on the memorial plaque. Next to it are memorial stones to the Knights of the Lāčplēsis War Order.
Cattle wagon used for deportations – museum at Skrunda train station
To commemorate the deportations of June 1941 and March 1949, a memorial stone and a four-axle wagon, which also serves as the museum dedicated to deportations, was erected at the Skrunda railway station. This is the first wagon-type museum in Latvia that holds a permanent exhibit of photos, letters, memoirs, documents and various items made by the people deported from the Skrunda station. Skrunda station was a location where deportees were gathered, and one of the three stations in the region to which people from the Skrunda and the Kuldīga area were brought. In 1941, the family of the first President of the restored Republic of Latvia, Guntis Ulmanis, was deported from here to Krasnoyarsk Krai in Siberia.
With the help of deportations, the Soviets dealt with supporters of the national partizans’ and at the same time intimidated the remaining rural population, forcing them to join the collective farms.
Exposition "Latvian Army in Pļaviņas in the 20th Century"
Located at Odzienas Street 2, Pļaviņas.
The permanent exposition "Latvian Army in Pļaviņas in the 20th Century" can be seen.
The building in Pļaviņas, Odzienas Street 2, has a long history - from the time when Stukmaņi wholesaler Hugo Apeltofts started active economic activity in it, thus promoting the development of Pļaviņas city, until the headquarters of the Latvian Eastern Front was established here during the War of Independence. In 1919, the activities of Latvian army units against the Red Army in Latgale were commanded directly from Pļaviņas.
In 1934, a memorial plaque was unveiled near this house with the inscription: "In 1919, the headquarters of the Eastern Front was located in this house, and here General Jānis Balodis took over the command of the Latvian National Army." It was removed and destroyed by the Soviets in 1940, but on June 16, 1990, with the support of the LNNK Plavinas branch, it was restored.
Now, next to the former headquarters building, there is a memorial stall dedicated to 15 cavalry of the Lāčplēsis Military Order born in Pļaviņas region. In Pļaviņas, as well as provides an insight into the life stories of the Knights of the Lāčplēsis War Order.
Not far from the exposition building is the Latgale Division headquarters building, which was built in 1913 by Count Teodors Medems as a Stukmaņi liqueur factory. In 1919 it was taken over by the regime of P. Stučka, where it had also established a prison. After the expulsion of the Bolsheviks, in 1925 the building was taken over by the Latvian Army, which housed the headquarters of the Latgale Division. 10 generals and other officers of the Latvian Army spent their military careers in this building. In 1940, the building was taken over by the Red Army. In the post-war years, it housed a school as well as a municipality. Around 1970, the building was started to be used by the production association "Rīgas Apīrsbs".
Visits to the exhibition must be booked in advance by calling T. 28442692.
Exhibition "Struggles for freedom in the 20th century" in Jēkabpils History Museum
Located in Krustpils Palace
Viewable exhibition "Fights for freedom in the 20th century"
Soviet repression. Hard memories. Sitting here in a club chair, you can listen to fragments of the book "Those were the times" by Ilmars Knaģ from Jēkabpils. On one of the walls of the room, a list of townspeople deported to Siberia slides dispassionately, like the credits after a movie. There you can watch an amateur video about the removal of the Lenin monument in Jēkabpils on the old TV. Visitors are interested not only in the content, but also in the technical possibilities - how did this film get on the old TV.
It is possible to listen to the lectures prepared by the museum specialists at the Jēkabpils History Museum or apply for an excursion: Jēkabpils and its surroundings in the First World War, Jēkabpils in 1990, the time of the Barricades, the deportations of 1949 - 70, Jēkabpilians Cavaliers of the Lāčplēš Military Order, etc.
The average duration of lectures is 40 min. Information and registration for lectures by calling 65221042, 27008136.
Jēkabpils History Museum is located in Krustpils Castle. In 1940, after the inclusion of Latvia in the USSR, the 126th Rifle Division was stationed in Krustpils Castle. During the Second World War, the castle housed a German infirmary, and after August 1944, a Red Army war hospital. After the war, Krustpils Castle with the adjacent manor buildings were occupied by the central warehouses of the 16th Long-range Reconnaissance Aviation Regiment and the 15th Air Army of the Soviet Army.
Alūksne Museum
The Alūksne Museum is located in an architectural monument of national significance: the neo-Gothic Alūksne New Castle built in the late 19th century. The museum features an exhibition named ‘Memorial Room for Victims of the Totalitarian Regime’, which tells about the fate of the inhabitants of Alūksne municipality in Siberia and the Far East, while the time periods from prehistory to the present meet in the Alūksne history exhibit ‘Feast of the Ages’. It features a separate section devoted to the contribution of the 7th Sigulda Infantry Regiment to the military, culture and public life. The formation of the 7th Sigulda Infantry Regiment began on 20 June 1919 in the Naukšēni Manor. Initially, a battle group of 22 officers and 1,580 soldiers was formed from the reserve battalion of the Northern Latvian Brigade, and was named the Dankers Division. It was included in the 2nd Battalion of the 3rd Jelgava Regiment. On 23 August, following an increase in the number of companies, it became part of the 7th Sigulda Infantry Regiment. Having taken part in the battles against Bermondt, on 5 January 1920, the regiment was transferred to the Latgale front to fight the Bolsheviks. After the signing of the Peace Treaty with Soviet Russia, the regiment guarded Latvia’s eastern border. The Latvian War of Independence saw the deaths of more than 200 soldiers of the regiment, while 85 were awarded the Lāčplēsis War Order. In 1921, the 7th Sigulda Infantry Regiment was stationed in Alūksne. The regiment’s headquarters were set up in the Alūksne New Castle. After World War II, the castle was taken over by Soviet security institutions. As of the late 1950s, the castle housed various cultural institutions: the Culture and Cinematography Department of the Executive Committee, a pioneer house, a library, a cinema and a museum.
Мемориальное место у станции Амата - эшелон № 97322
Находится в Драбешской волости Аматского уезда, недалеко от бывшего здания вокзала Амата.
Можно осмотреть мемориал депортированным с информационным щитом и сквером.
Всего 25 марта 1949 года и в последующие дни из Латвии в 33 эшелонах было вывезено более 42 тысяч человек.
27 марта 1949 года в два часа ночи со станции Амата выехал эшелон № 60 длинновагонов. 97322, из них 329 мужчин, 596 женщин, 393 ребенка.
Центральным объектом станут 1318 металлических столбов различных размеров и цветов. Каждый из них символизирует человека, взятого 25 марта 1949 года из тогдашних Цесисского и Алуксненского уездов. В каждой графе имя, фамилия, год рождения и приход - из которого человек был послан. На данный момент при поддержке самих депортированных или их родственников установлен 21 пост.
У автора идеи, самого Петериса Озоласа, тоже есть свой столб, который был взят из «Перконю» Косской волости вместе со своей семьей в возрасте шести лет 25 марта 1949 года.
Информация о депортации 1949 г. и операции «Прибой», проведенной репрессивными органами СССР в оккупированных Прибалтике, послужившей основанием для депортации, можно прочитать на информационном стенде.
Памятники павшим и депортированным жителям прихода Палсмане
Находится недалеко от лютеранской церкви Пальсмане.
Достопримечательности - павшим и пропавшим без вести во время Освободительной войны Латвии, павшим во время Второй мировой войны и пропавшим без вести, а также памятник депортированным в 1949 году жителям Палсманской волости.
Памятник был открыт в 1927 году жителям Палсманской волости, погибшим в Латвийской войне за независимость и пропавшим без вести. Он был открыт генералом Эдуардом Эйром (1876–1933).
Средства на создание памятника пожертвовали ассоциации и общественные организации Палсманской, Мерской и Раужской волостей.
Мемориал национальным партизанам во главе с Дайлонисом Брейксом «Дайнькални».
Находится в «Дайнькални», Раунская волость, Раунский край (недалеко от Смилтенского края, дом «Межвию» Брантской волости.
Добраться до мемориала можно только раз в году - 16 апреля! Дорога проходит через частную собственность.
Мемориальный комплекс находится на месте бывших домов «Дайнькални» и «Грашкални» в волости Рауна, под которыми в бункерах, созданных с 1950 по 1952. Группа национальных партизан Д. Брейкса была создана в 1948 г. и до 1950 г. проживала в «Яунвиеславены» Гатартской волости у владельца Карлиса Лачса. В 1950 году партизанский отряд Д. Бриксиса был передан его родным братом Лаймонисом, поэтому они были вынуждены переехать. Летом они жили в лесах, а зимы проводили в Раунской волости «Дайнькалны» у лесничего Артура Перконса (1907-1952) и в соседних бункерах «Грашкалны», устроенных под домом.
С 2002 года мемориал в Дайнькалнсе постепенно благоустраивается. Мемориальные мероприятия проводятся каждый год 16 апреля в память о национальных партизанах во главе с Дайлонисом Брейксом. В апреле 2003 и 2004 годов возле домов Дайнькалны и Грашкалны были установлены памятные кресты и таблички. Осенью 2016 г. - весной 2017 г. с помощью местных жителей Раунены по эскизу архитектора З. Бутанса был реконструирован мемориал, а также раскопано и укреплено место бывшего бункера.
Памятник памяти членов Друстуского прихода, павших в Первой мировой войне и в боях за освобождение Латвии
Он расположен недалеко от лютеранской церкви Друсту.
Памятник был открыт 19 июня 1932 года.
14 июня 1931 года был заложен первый камень памятника, на котором написано «Сотни лет придут и уйдут, герои пожертвуют собой ради отцовства». Под ней вложена оцинкованная жестяная капсула с памятной грамотой, подписанной тогдашним начальником штаба армии генералом Александром Калейсом, родителями погибших воинов и другими почетными гостями церемонии.
Во время коммунистической оккупации текст под вкладкой был зацементирован, а бронзовая вкладка была спрятана прихожанами. Когда началось Возрождение, местные активисты Латвийского народного фронта очистили надпись и поставили на ее место сохранившуюся вкладку.
Установлены личности 41 члена общины Друсту, погибших в Первой мировой войне и Освободительной войне Латвии.
В нишах церковной стены установлены мемориальные доски жертвам коммунистического террора - с высеченными на дубе именами 58 друстенцев и гатарцев - именами людей, могилы которых неизвестны.
Gräber von Soldaten von Rubens Bataillon
Die Gräber der Soldaten des Bataillons von Ruben befinden sich an der Landstraße Kuldīga - Sabile. Ein Straßenschild und ein Stein mit der Aufschrift „Für dein Land und deine Freiheit“ befinden sich nur wenige hundert Meter von der Straße entfernt.
Das Bataillon von Leutnant Robert Rubenis war einer der Teile der von General Jānis Kurelis gebildeten Militäreinheit, die sich den deutschen Truppen nicht ergab und heftigen deutschen Widerstand leistete. Während der Usma-Zeit stieg die zahlenmäßige Zusammensetzung des Bataillons auf 650 Mann mit vier voll ausgerüsteten Kompanien, einem Krankenwagen und einem Farmteam. Kommandant: Leutnant R. Rubenis, Leutnant Filipsons, vv A. Druviņš, vv Šults, vv Briedis, vv. Sergeant J. Rubenis, J. Bergs, vv Jaunzems.
Vom 14. November bis 9. Dezember 1944 fanden in den Pfarreien Ugāle, Usma, Renda und Zlēki erbitterte Kämpfe zwischen Einheiten der 16. deutschen Armee, SD- und SS-Einheiten unter dem Kommando von Polizeigeneral Friedrich Jekeln und einem eigenen Bataillon der Kurelische Einheit unter dem Kommando von Leutnant Roberts Rubenis. In den Kämpfen bei Renda und Zleki wurden rund 250 deutsche Soldaten getötet, während die Verluste der Rubenes bei rund 50 Menschen lagen.
Nach dem Tod von Leutnant Rubenis kündigte Druviņš seinen Männern an, dass er weiterhin nach dem Prinzip des freien Willens arbeiten werde, und infolgedessen trafen mehrere Dutzend Männer die Entscheidung, sich von Rubenis 'Bataillon zu trennen. Am 20. und 21. November 1944 wurde eine Gruppe von 11 Personen von einer deutschen SD-Einheit gefangen genommen und nach Verhören in den örtlichen Wald gebracht und erschossen.
Die Gräber der Brüder der nationalen Partisanen in der Nähe der "Dzelzkalni"-Häuser
FÜR DIE NATIONALEN PARTISANEN
ICH BIN WIEDER UNTER EUCH IN DER WÄSCHEREI
WEIL ES AUF DER ANDEREN SEITE WAR, WÜRDE ES GEHEN
IN IHRER GEMEINDE UND AUF DEN WEGEN IHRER VORFAHREN
ERWARTE MICH ZURÜCK
Auf der Granitplatte am Fuß des Denkmals sind die Jahreszahlen (1945 - 1953) und die Namen von 36 gefallenen Partisanen eingraviert.
Am 23. Februar 1946 kam es in der Gemeinde Tārgale bei Vārnuvalkas zu einer blutigen Schlacht zwischen der Gruppe lettischer nationaler Partisanen unter Führung von Kommandant Brīvnieks auf ihrem Lagerplatz und der Jagddivision der sowjetischen Besatzungsarmee. Sechs Partisanen starben in der Schlacht, und die Anwohner begruben sie heimlich direkt dort im Wald. Später wurden dort zwei weitere Erschossene ohne Prozess und Urteil bestattet. Lokal wurde diese Ecke des Waldes Dzelzkalns-Gräber genannt, die viele Jahre lang nur Experten zu finden wussten - durch das Zeichen des Kreuzes in der Tanne.
Auf dem Friedhof wurde ein Denkmal zur Erinnerung an die nationalen Partisanen errichtet. In Stein gemeißelte Namen von Partisanen, die in der Partisanengruppe Puze-Pilten arbeiteten. Daneben befindet sich auch ein Gedenkstein für Leutnant Robert Ruben.
Im Sommer 1989 platzierten die Mitglieder des Ugāle-Zweigs der LNNK im Dezkalni-Gebiet von Zūru meža Birkenkreuze auf der nationalen Grabstätte der Puzes-Piltenes-Gruppe, die am 23. Februar 1946 gefallen war, und suchten danach Angehörige der Gefallenen in Lettland und im Ausland.
Am 27. April 1991 wurden die Gräber unter Beteiligung von Angehörigen der Gefallenen und Vertretern nationaler Organisationen aus mehreren Ländern vom Theologieprofessor Roberts Akmentiņš eingeweiht und sie wurden die Gräber der Eisernen Brüder genannt.
Am 20. Juni 1992 wurde auf dem Friedhof ein von August Adler geweihtes Denkmal eröffnet. Das Denkmal wurde von Kārlis Stepans nach dem von der LNNK-Niederlassung Ugāle geplanten Entwurf mit geringfügigen Änderungen hergestellt. Die Kosten wurden von wenigen Personen gedeckt. Das Denkmal wurde aufgestellt und die Fundamente wurden von Wachen des Wachregiments Ventspils, Mitgliedern der LNNK- und LDV-Zweigstellen Ugāle geschaffen. Der Text ist im oberen Teil des Denkmals eingraviert:
Liepāja-Milizgebäude oder "Blaues Wunder"
In Liepāja befand sich die Miliz, die Institution des kommunistischen Besatzungsregimes, in der Republikas-Straße 19, einem Gebäude, das seit seiner Errichtung im 20. Jahrhundert genutzt wurde. Am Anfang nannten es die Leute aus Liepāja das "Blaue Wunder". Andererseits befand sich der Hauptsitz der Kontrolle in der Toma Street 19. Kurz nach der Besetzung erhielt sie in der Gesellschaft den Namen "Rotes Wunder".
Im Zuge der bisherigen Ermittlungen zu den Verbrechen des kommunistischen Regimes wurde festgestellt, dass weder direkt im Gebäude der Liepaja Tscheka, also im „Roten Wunder“, noch im Gefängnis Hinrichtungen oder außergerichtliche Erschießungen stattgefunden haben. Aufgrund des Beginns des Krieges auf dem Territorium Lettlands wurden alle Häftlinge, die sich an diesen Orten befanden, ab dem 23. Juni 1941 in russische Gefängnisse verlegt. Dies betraf sowohl Inhaftierte, die wegen sogenannter „politischer“ Straftaten festgenommen wurden, als auch kriminelle Kriminelle, unabhängig davon, ob gegen die Person ermittelt wurde oder bereits eine Strafe verhängt worden war.
Die Überstellung der Gefangenen wurde durch den Befehl Nr. 2455/M des Volkskommissars für Staatssicherheit der UdSSR Vsevolod Merkulov vom 23. Juni 1941 bestimmt, der an die Chefs des NKGB der Lettischen SSR, der Estnischen SSR, gerichtet war und mehrere Regionen der Ukrainischen SSR. Der Grund für die Schießerei war schrecklich und tragisch – es war nicht mehr möglich, die Inhaftierten nach Russland zu überstellen, aber sie konnten nicht am Leben gelassen werden. Infolgedessen kam es in Liepāja während des Krieges zu außergerichtlichen Erschießungen von Bewohnern, ähnlich wie in den Fällen im Rigaer Zentralgefängnis, im Valmiera-Gefängnis, bei den Milizen Valka und Rēzekne sowie auf dem Croix-Hügel bei Ludza. Das erwähnte Verbrechen ereignete sich im „Blauen Wunder“ – Milizgebäude Liepāja, Republikas-Straße 19.
„Waldbrüder“ - Bunker nationaler Partisanen
Der Bunker der sog. Waldbrüder liegt an der Fernstraße A 2 Riga-Pskow, 76 km von Riga und 11 km von Cēsis entfernt. Die lettischen nationalen Partisanen, auch Waldbrüder genannt, waren kleine bewaffnete Gruppen von Einheimischen, die von 1944 bis 1956 auf sich gestellt gegen das sowjetische Besatzungsregime in Lettland kämpften. Es waren Menschen, die nicht in der Sowjetunion leben konnten oder wollten und gezwungen waren, sich in den Wäldern zu verstecken. In ganz Lettland waren etwa 20.193 Waldbrüder aktiv. Der Bunker wurde nach Berichten und Erinnerungen ehemaliger Waldbrüder über das Leben in Wäldern und Verstecken und den Kampf für einen unabhängigen lettischen Staat nach 1945 errichtet. Im Bunker sind Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände, persönliche Gegenstände, Waffen und Fotos von Partisanen ausgestellt. Videoaufzeichnungen von Interviews mit ehemaligen Waldbrüdern ergänzen die Ausführungen des Ausstellungsführers. In der Nähe des Bunkers wurde ein Lagerfeuer-Picknickplatz angelegt. Zum Angebot gehören auf dem Lagerfeuer gekochte Suppe, Abende am Lagerfeuer und Freiluftkino (alles nach Vorbestellung).
„Die Sowjetjahre“ - Ausstellung des Museums für Geschichte und Kunst Aizkraukle
Die Ausstellung ist im ehemaligen Kulturhaus der Gemeinde Aizkraukle untergebracht. Sie beleuchtet Lebensalltag, Arbeitswelt, Freizeit, Kultur und Bildung des Sowjetbürgers. Darüber hinaus geht es um die Geschichte von Aizkraukle, einen Ort, der in der Sowjetzeit Stučka genannt wurde, und den Bau des Wasserkraftwerkes Pļaviņas. Zu sehen sind die mit Agitationsmitteln der damaligen Zeit dekorierte „Rote Ecke“, das Büro eines Parteifunktionärs, eine typische Wohnung aus der Sowjetzeit mit Wohnzimmer, Küche, Bad und Toilette und den dazugehörigen Attributen. Ein Teil der Ausstellung ist der Medizin, dem Tourismus, dem Sport und dem Repressionssystem der Sowjetzeit gewidmet. Den Mittelpunkt der Ausstellung bildet eine Halle mit Autos aus der Sowjetzeit. Das Museum für Geschichte und Kunst in Aizkraukle begann 2016 mit dem Aufbau der sich über drei Etagen erstreckenden Ausstellung. Sie ist derzeit die größte Schau ihrer Art im Baltikum, die der sowjetischen Besatzungszeit gewidmet ist.
Gedenkstätte für die erschossenen Patienten des psychiatrischen Krankenhauses Aglona Catholic Gymnasium
Eine Gedenkstätte in der Nähe des katholischen Gymnasiums Aglona, wo die Nazis am 22. August 1941 544 Patienten der psychiatrischen Klinik Daugavpils sowie 48 Kinder aus dem Waisenhaus Grivas erschossen. Alle genannten wurden von Daugavpils nach Aglona verlegt, wo sie bis zu ihrer Ermordung in den Räumlichkeiten des katholischen Gymnasiums untergebracht wurden. Die Schüsse wurden in zwei Gruben vergraben.
Diesen Mord sowie die Tötung der umliegenden Juden verurteilte der Dekan von Aglona, Pfarrer Alois Brock (1898–1943), in seinen Predigten öffentlich. Aus diesem Grund wurde er am 30. Dezember 1941 von den NS-Behörden verhaftet. Nach drei Monaten wurde A. Brock freigelassen, am 25. Mai 1942 jedoch erneut verhaftet. A. Brock starb am 28. April 1944 in einem Konzentrationslager in Neuengammam (Deutschland) oder Mauthausen (Österreich).
An der Gedenkstätte befinden sich einige Grabsteine und ein Kruzifix mit einer Gedenktafel in lettischer und russischer Sprache.
Die Ausstellung „Region Ludza 1918-1945 Mögen Sie für immer in Lettland leben!“ im Heimatmuseum Ludza
In der Ausstellung des Regionalkundemuseums Ludza „Lang lebe Lettland!“ 1918–1945“ spiegelt eine wichtige historische Etappe in der Entwicklung Ostlatgalens von 1918–1945 wider. für das Jahr. In der Ausstellung sind verschiedene Relikte dieser historischen Epoche zu sehen. Darunter befinden sich auch Gegenstände, die einst R. Kalniņas gehörten, einem Bürger von Lužana, einem Teilnehmer des Freiheitskampfes. Die künstlerische Gestaltung des Raumes lässt die Besucher die Stimmung der Zeit spüren, als Lettland von einer Welle massenhafter Deportationen heimgesucht wurde. Das zentrale Relikt, das diese historische Periode darstellt, ist ein Holzkreuz, das vom unterdrückten katholischen Priester Casimir Vitanis angefertigt wurde. Die Installation auf dem Schlachtfeld des Zweiten Weltkriegs schafft eine emotional lebendige Atmosphäre dieser Zeit. Besucher der Ausstellung können sich auch mit den Kriegsauszeichnungen der Sowjetarmee und der Deutschen Armee vertraut machen. Die in der Ausstellung gezeigten alten Fotos von Ludza geben den Besuchern einen Eindruck vom Bild der Stadt vor und nach dem Zweiten Weltkrieg.
Gedenkstätte für die Opfer des Dorfes Audriņi
Die Gedenktafel am ehemaligen Gefängnis Rēzekne wurde 1965 eröffnet. Gewidmet den dreißig Männern des Dorfes Audriņi, Gemeinde Makašēni, die am 4. Januar 1942 an diesem Ort öffentlich erschossen wurden. Auf der Platte sind die Namen der 30 Erschossenen eingraviert.
Kurz zuvor wurde bekannt, dass sich im Dorf Audriņi entflohene Kriegsgefangene der Roten Armee versteckt hielten. Bei den bewaffneten Auseinandersetzungen, die während ihrer Gefangennahme ausbrachen, wurden vier Hilfspolizisten getötet. Als Rache für den Vorfall ordneten die Nazi-Besatzungsbehörden die Tötung aller Einwohner von Audriņi und das Niederbrennen des Dorfes an. Die öffentliche Hinrichtung in Rezekne war Teil eines Rachefeldzugs.
Holocaust-Mahnmal
Im August 2004 wurde in der Cēsu-Straße in Preiļi ein Denkmal für die Opfer des Holocaust eröffnet. Architekt Sergejs Rižs, aber der Autor und Finanzier der Idee ist Dāvids Zilbermanis, ein Einwohner der USA. Die Gedenkstätte befindet sich im Bereich zwischen den jüdischen Zivilgräbern und den Erschießungsgruben der jüdischen Bevölkerung.
Die ersten Juden kamen zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach Preiļi, als sich die Stadt Preiļi zu bilden begann. Laut der Volkszählung von 1935 waren 847 (51 %) der 1.662 Einwohner von Preiļi Juden. Die meisten von ihnen waren Kaufleute, Handwerker sowie Intellektuelle – Ärzte und Lehrer.
Als die deutsche Nazi-Armee 1941 einmarschierte Am 28. Juli, 9. und 10. August wurden mehr als 720 Juden aus Preiļi und Umgebung vernichtet. Nach dem Krieg kehrten einige Juden nach Preili zurück, doch der Wiederaufbau der Gemeinde scheiterte.
In den Jahren 2013 und 2014 führten Schüler des Deutschen Jugendverbandes LOT und dessen Leiter Klaus Peter Rex Reinigungs- und Denkmalreinigungen auf dem Friedhof jüdischer Bürger durch. Es wurde eine Karte des Friedhofs erstellt. Im Jahr 2015 wurde auf Initiative von Dāvid Zilbermanis mit seinen Mitteln und Spenden ein Gedenkbogen für die jüdische Gemeinde in Preilii am Eingang zum jüdischen Bürgerfriedhof auf dem Weg zum Denkmal für die Opfer des Holocaust eröffnet.
Im Jahr 2018 führte der Verein „Preiļu Memorialials“ (Vorsitzender Sergejs Rižs) Ausgrabungsarbeiten an der Stelle durch, an der die Juden neben dem Friedhof jüdischer Bürger getötet wurden. Es wurden drei Grubenstandorte entdeckt. Nach der Konservierung können die materiellen Zeugnisse in der Hauptausstellung des Museums für Geschichte und angewandte Kunst Preiļi am Rainiš-Boulevard 28 besichtigt werden. Museumsspezialisten bieten den Besuchern das Bildungsprogramm „Über den Holocaust nachdenken bedeutet, über sich selbst nachzudenken“. Das Programm beginnt bei der Museumsausstellung und endet am Holocaust-Mahnmal. Die Gedenkstätte dient zusammen mit dem Friedhof der öffentlichen Bildung als Freilichtmuseum.
Denkmal für politisch unterdrückte und nationale Partisanen in Preilii
Das Denkmal für die politisch Unterdrückten in Preili befindet sich auf dem Platz in der Nähe des Tores der römisch-katholischen Kirche und wurde am 22. August 1993 eröffnet. Das Denkmal wurde vom Bildhauer Vija Dzintare geschaffen. Das Denkmal zeigt eine trauernde Frau auf den Knien, die den Verstorbenen mit einer Decke zudeckt. Neben dem Denkmal sind die Worte des Dichters Kārlis Skalbe in Stein gemeißelt:
Viele Märtyrer wurden ausgewählt
Für dich, mein kleines Vaterland,
Was ist mit dem Namen der heiligen Mutter?
Flüstern in der Stunde des Schmerzes: „Latvija!“
Da in den 1940er Jahren des 20. Jahrhunderts Vertreter der sowjetischen Besatzungsmacht die sterblichen Überreste erschossener nationaler Partisanen öffentlich zur Schau stellten, wurde die Gedenkstätte 2018 erweitert. Neben dem Denkmal wurden zwei Felsbrocken aufgestellt, die die Erinnerung an die nationalen Partisanen symbolisieren. Die Findlinge wurden vom Bildhauer Ivo Folkmanis geschaffen. Auf einem von ihnen ist das Logo der politisch unterdrückten Preiļi-Gesellschaft „Likteņa ceļs“ eingraviert, auf dem anderen die Inschrift „In Erinnerung an die gefallenen Mitglieder der Nationalen Widerstandsbewegung“.
Am 25. März und 14. Juni finden hier Gedenkveranstaltungen für die Opfer politischer Repressionen statt.
Seotud lood
Über General Karl Gopper
General K. Goppers (1876-1941) war ein hervorragender Soldat und ein hervorragender Mann. Er zeichnete sich als erfolgreicher Kommandant aus, der das Kommando über das Bataillon und die Regimenter übernahm und seine Schützen während des Ersten Weltkriegs (1914-1919) heldenhaft in den Kämpfen für die Freiheit Lettlands führte. Er hat an den Kämpfen in Tīreļpurvs, Ložmetējkalns teilgenommen und Riga verteidigt.
Das Leben von General Jānis Balozs nach der Rückkehr von der Deportation
Als die Russen 1940 versuchten, der lettischen Regierung ein Militärstützpunktabkommen zu erzwingen, das es der lettischen Armee fast unmöglich machen würde, der Roten Armee zu widerstehen, versucht General J. Balodis, einige Änderungen an diesem Abkommen durchzusetzen. Aber es scheitert. Doch die Bösewichte des Generals nutzen diesen Umstand, um J. Balodi später fast als Verräter zu korrigieren. Nach einem Konflikt mit dem Ministerpräsidenten des Staates und Ministerpräsident K. Ulmanis wurde der General am 5. April 1940 vom Posten des Kriegsministers abberufen. Dann beschließt J. Balodis, an den Saeima-Wahlen aus dem Demokratischen Block teilzunehmen, aber es kommt nichts dabei heraus, weil nur eine Liste zur Wahl stehen darf - die Liste der kommunistischen Kandidaten. Lettland wird die 14. Sowjetrepublik.
Über die Besetzung Lettlands
Die Existenz des unabhängigen Staates Lettland im Jahr 1940 wurde durch die Besetzung und Annexion durch die Sowjetunion oder die Eingliederung in die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) unterbrochen.
Über die Ereignisse der Kinderkolonie "Zwerge" während der Vorkriegszeit und des Zweiten Weltkriegs
Den Familien der Guerilla-Anhänger wurden ihre Kinder entzogen. Im März 1943 befanden sich 1100 Kinder im Lager Salaspils. Etwa 250 Kinder starben an Masern, Typhus und anderen Krankheiten, mehrere Hundert Kinder wurden auf die Bauernhöfe der umliegenden Gemeinden überführt, etwa 300 Kinder landeten in den Waisenhäusern in Rigas Jurmala, Igate und Saulkrasti.
In Saulkrasti landeten die Kinder in der Kinderkolonie „Rūķīši“ des Lettischen Kinderhilfswerks.
Die kommandierenden Fähigkeiten von Major Jānis Ozol während der 3. Schlacht von Kurzeme
Ein Gedenkschild für die Teilung von Major Jānis Ozolas wurde an der Seite der Autobahn Riga - Liepāja in der Gemeinde Džukste, etwa einen Kilometer von den kurländischen Nebenflüssen der Gedenkstätte entfernt, aufgestellt.
Major Jānis Ozols war ein lettischer Offizier, Teilnehmer am 2. Weltkrieg, Ritter des Drei-Sterne-Ordens, dessen Artilleriedivision er befehligte, um einen Frontdurchbruch in der 3. Schlacht von Kurland zu verhindern.
„Tagebuch des besetzten Lettlands“ des lokalen Forschers Žanis Skudra
Žanis Skudra widmet seine gesamte Freizeit der lokalen Forschung, alle seine Ferien Reisen durch Lettland. So wurden Materialien und Fotografien gesammelt und das „Buch der Tage des besetzten Lettlands“ vom Lettischen Nationalfonds in Stockholm unter dem Pseudonym Jānis Dzintars herausgegeben.
Am 7. Juni 1978 wurde Žani Skudra in Tallinn festgenommen und im November desselben Jahres vom Obersten Gerichtshof von Riga wegen Hochverrats und Spionage zu zwölf Jahren Haft verurteilt.
Die Rolle des ehemaligen Leutnants der Legion, Arvīdas Gailīš, bei der Liquidierung der Gruppe von Pēteris Chever
Kapitän Pēteri Čevera und sieben weitere Partisanen wurden am 1. November 1950 im Waldmassiv Engure gefangen genommen, wo sich zufällig die Gruppe falscher Partisanen des ehemaligen Legionsleutnants Arvīdas Gailīš (Spitzname des Agentenkämpfers "Grosbergs") stationiert hatte. Es umfasste Aktivisten der LPSR VDM und militante Agenten, die die Rolle von "Waldbrüdern" spielten.
Die Geschichte von Peter Cheevers Bandenaktivitäten und Zerstörung
P. Chevers versammelte ehemalige Offiziere der Legion um sich und begrüßte auch die Einwohner von Kurzeme in der Gruppe. Sie alle entschieden sich dafür, der Idee eines freien und unabhängigen lettischen Staates treu zu bleiben, anstatt sich einer fremden Besatzung zu unterwerfen. Die Chever-Gruppe wurde auf dem Gebiet der Gemeinden Vandzene - Upesgriva - Okte des Bezirks Talsi eingesetzt und versuchte, frontale Zusammenstöße mit tschechischen Truppen oder Kämpfern des Jagdbataillons zu vermeiden
Außergerichtliche Erschießung von Zivilisten im "Blauen Wunder" von Liepāja
Außergerichtliche Tötungen auf lettischem Gebiet während des Krieges, Ende Juni und Anfang Juli 1941, waren die letzte Manifestation von Unterdrückung und Gewalt in der ersten Phase der kommunistischen Besatzung, die mit dem Einmarsch nationalsozialistischer deutscher Truppen in das gesamte Gebiet endete von Lettland.
Der Grund für die Schießerei war schrecklich und tragisch – es war nicht mehr möglich, die Inhaftierten nach Russland zu überstellen, aber sie konnten nicht am Leben gelassen werden. Infolgedessen kam es in Liepāja während des Krieges zu außergerichtlichen Erschießungen von Bewohnern, ähnlich wie in den Fällen im Rigaer Zentralgefängnis, im Valmiera-Gefängnis, bei den Milizen Valka und Rēzekne sowie auf dem Croix-Hügel bei Ludza. In Liepāja wurde dieses Verbrechen der sowjetischen Besatzungsmacht im „Blauen Wunder“ – Liepāja-Milizgebäude, Republikas-Straße 19, verwirklicht.