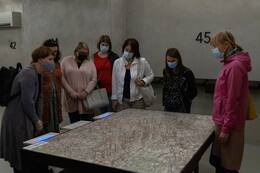Warten II Zweiter Weltkrieg
Eine der Säulen der sowjetischen Macht war eine spezielle Repressionsstruktur, die im Volksmund als Tscheka bekannt war. Die Bolschewiki gründeten sie kurz nach ihrer Machtergreifung in Russland im Dezember 1917. Eine Allrussische Außerordentliche Kommission wurde ins Leben gerufen, um Gegner der Bolschewiki aufzuspüren und physisch zu unterdrücken. Der russische Name der Kommission – Wserossijskaja Tscherzwitschjana Komisija – wurde zu Tscheka verkürzt. Daraus entstand der Begriff, der später, unabhängig von Änderungen des offiziellen Namens, für das gesamte Repressionssystem verwendet wurde.
Am 17. Juni 1940 marschierten Spezialeinheiten der inneren Angelegenheiten zusammen mit regulären sowjetischen Truppen in Lettland ein und nahmen die Aktivitäten der Tscheka auf. Sie operierte bis 1991 in Lettland und ist für den Tod sowie das physische und psychische Leid Tausender lettischer Bürger verantwortlich.
Die Aktivitäten der Tscheka in Lettland sind eng mit dem Gebäude an der Ecke Brīvības- und Stabu-Straße verbunden. Die Institution begann kurz nach Beginn der Besatzung im September 1940 mit dem Umbau des Gebäudes. Lettische Bürger, die vom Besatzungsregime als Gegner galten, wurden dort inhaftiert, verhört und 1940/41 auch getötet. Mindestens 3.355 politische Strafverfahren wurden 1940 und 1941 eingeleitet. Viele der Inhaftierten wurden später in Massengräbern in Baltezers, Babīte, Dreiliņi, Stopiņi sowie im Hof des Rigaer Zentralgefängnisses gefunden. Mit dem Ausbruch des Krieges gegen Deutschland Ende Juni 1941 deportierte die Tscheka etwa 3.600 politische Gefangene in Gefängnisse der UdSSR. Insgesamt waren 1940/41 etwa 26.000 Letten direkt von der politischen Verfolgung betroffen.
Die Unterdrückung der Gegner der Sowjetmacht wurde nach dem Zweiten Weltkrieg fortgesetzt und richtete sich hauptsächlich gegen lettische Partisanen und Mitglieder der antisowjetischen Widerstandsbewegung. In den Nachkriegsjahren fanden im Eckhaus Ermittlungen statt, Todesurteile wurden jedoch im Zentralgefängnis Riga vollstreckt. Die Methoden der Tscheka änderten sich nach Stalins Tod 1953 leicht. Physische Folter wurde durch psychische ersetzt.
In späteren Jahren, als der Widerstand gegen das Sowjetregime effektiv niedergeschlagen wurde, waren physische Repressionen selten, doch die Tscheka kontrollierte die Gesellschaft weiterhin und hielt sie in Angst und Schrecken. Die Operationsmethoden der Tscheka in Lettland sind aufgrund fehlender Dokumente nicht detailliert und umfassend erforscht worden. Ermittlungsakten und Ausweise freiberuflicher Tscheka-Agenten werden zwar in Lettland aufbewahrt, Mitarbeiterlisten und Dienstakten hingegen in Russland. Sie stehen den lettischen Behörden und Forschern nicht zur Verfügung.
Weitere Informationsquellen
Lettisches Besatzungsmuseum / Was war der Scheck? Verfügbar unter: http://okupacijasmuzejs.lv/lv/apmekle/izstade-cekas-vesture-latvija/kas-bija-ceka/ [Zugriff: 06.05.2021]
Zugehörige Zeitleiste
Zugehörige Objekte
Ausstellung zur Geschichte des KGB in Lettland im sog, “Eckhaus”
Das Gebäude der ehemaligen „Tscheka“ – des Staatssicherheitskomitees der UdSSR (später KGB) – in Riga ist heute öffentlich zugänglich. Hier wurden lettische Bürger von im Volksmund so genannten Tschekisten festgehalten, verhört und umgebracht, weil sie das Besatzungsregime als Gegner betrachtete. In dem Gebäude ist heute eine Ausstellung des Lettischen Okkupationsmuseums über die Aktivitäten des KGB in Lettland untergebracht. Es werden Führungen durch Zellen, Gänge, Keller und den Innenhof angeboten. Das Haus wurde 1911 erbaut und zählt zu den schönsten Bauten in Riga. Im Volksmund als „Eckhaus“ bekannt, wurde es zum schrecklichen Symbol des sowjetischen Besatzungsregimes in Lettland - eine der Stützen der Sowjetmacht. Die Tscheka nutzte das „Eckhaus“ während der sowjetischen Besatzung 1940/41 und dann erneut von 1945 bis 1991. Zehntausende Einwohner Lettlands waren von politischer Verfolgung direkt betroffen. Das harte Vorgehen gegen Gegner der sowjetischen Herrschaft wurde auch nach dem Zweiten Weltkrieg fortgesetzt. Nach Stalins Tod änderten sich die Methoden des KGB unwesentlich. An die Stelle von physischer Folter trat nun Psychoterror. Die Mehrheit der Tscheka-Agenten bestand aus ethnischen Letten (52 %). Russen bildeten mit 23,7 % die zweitgrößte Gruppe. 60,3 % der Mitarbeiter gehörten nicht der Kommunistischen Partei an, 26,9 % verfügten über einen Hochschulabschluss. Das System war darauf ausgerichtet, die lokale Bevölkerung einzubinden und so die Kontrolle über die Gesellschaft zu erlangen. Die Korrespondenz und die Akten der KGB-Mitarbeiter befinden sich heute in Russland. Sie sind für lettische Behörden und Historikern nicht zugänglich.
Das Hauptquartier der nationalen Partisanen im Naturschutzgebiet „Stompaku-Sümpfe“
Während des Zweiten Weltkriegs war der Stompaku-Sumpf eines der größten nationalen Partisanenlager im Baltikum. Heute ist das Gebiet Teil des Naturschutzgebiets Stompaku-Sümpfe. Die Siedlung auf den Sumpfinseln ist über einen markierten Steg zu erreichen.
Anfang 1945 lebten 350–360 Personen, darunter 40–50 Frauen, im Lager der nationalen Partisanen im Stompaku-Sumpf. Das Lager bestand aus 24 halb in den Boden eingebauten Wohnbunkern, die Platz für 3–8 Personen boten. Es gab eine Bäckerei, einen Kirchenbunker und drei oberirdische Anlagen für Pferde. Partisanen aus dem Lager verübten Anschläge auf führende Kräfte des Besatzungsregimes.
Am 2. und 3. März 1945 fand hier die Schlacht von Stompaki statt – die größte in der Geschichte der lettischen Nationalpartisanen. Die 350–360 Partisanen im Lager wurden vom 143. Gewehrregiment des NKWD und lokalen Kämpfern des Istrebikel-Bataillons (insgesamt 483 Mann) angegriffen. Die Schlacht dauerte den ganzen 2. März. In der Nacht zum 3. März gelang es den Partisanen, aus dem Lager auszubrechen und sich in ihren vorherigen Stützpunkt zurückzuziehen. Die Schlacht forderte 28 Partisanen, während der NKWD 32 Kämpfer verlor. Heute befinden sich auf dem Gelände des Lagers Stompaki drei restaurierte Bunker – eine Kirche, ein Hauptquartier und ein Wohnbunker sowie 21 ehemalige Bunkerstandorte. Es wurden Informationstafeln über das Lager und die Schlacht aufgestellt. Es können Führungen gebucht werden
Denkmal „Weißes Kreuz“ in Stopiņi
Im Wald gelegen, 50 m von der Autobahn V36 entfernt, auf dem Abschnitt vom Dorf Jugla (Papierfabrik) bis zur Autobahn P4.
Zwischen dem 3. Februar und dem 25. März 1941 wurden an dieser Stätte 23 Menschen in vier Gruben bestattet. Die Opfer waren im Tscheka-Gebäude in Riga erschossen worden. Die Exhumierung fand am 27. April 1944 statt. Damals konnten 14 der Bestatteten identifiziert werden, und heute sind dank der Forschung alle an dieser Stätte Bestatteten identifiziert.
Das Weiße Kreuz wurde am 12. Juli 1991 an diesem Ort als Mahnmal für die Opfer des kommunistischen Besatzungsregimes errichtet. Es wurde von Mitgliedern der Volksfront und Einwohnern des Bezirks Stopiņi gefertigt und aufgestellt. 1998 wurde in der Nähe des Weißen Kreuzes ein Gedenkstein des Bildhauers Uldis Sterģis mit der Inschrift „Den Opfern des russischen Imperialismus 1941“ aufgestellt.
Hier wurden begraben: Jānis Bergmanis (1900-1941), Alberts Bļodnieks (1904-1941), Kārlis Goppers (1876-1941), Arveds Laane (1916-1941), Ernests Ošs-Oše (1882-1941), Antons Pacevičs (1901-1941), Jāzeps Pošeiko (1897–1941), Arnolds Smala (1912–1941), Jāzeps Stoļers (1903–1941), Walfrīds Vanks (1888–1941), Zenons Vjaksa (1904–1941), Viktors Kopilovs (1904–1941), Kārlis Prauls (1895-1941), Artūrs Salnājs (1904-1941), Evgenijs Simonovs (1896-1941), Eduards-Verners Anerauds (1897-1941), Efraims Gorons (1910-1941), Pēteris āaksa-Timinskis (1913-1941), Pēteris Melbārdis (1892–1941), Izraels Paļickis (1911–1941), Jānis Priedītis (1897–1941), Jānis-Arnolds Stālmanis (1913–1941), Aleksandrs Weinbergs (1884–1941).
Lettisches Okkupationsmuseum
Die Museumsausstellung beleuchtet die Geschichte Lettlands von 1940 bis 1991, also die nationalsozialistische und die sowjetische Besatzungszeit.
Das „Haus der Zukunft“ ist ein Projekt des renommierten lettisch-amerikanischen Architekten Gunārs Birkerts zur Renovierung und Erweiterung des lettischen Okkupationsmuseums sowie zur Schaffung einer neuen Ausstellung. Die Ausstellung „Die Geschichte des KGB in Lettland“ befindet sich im sog. Eckhaus, dem ehemaligen Gebäude des Staatssicherheitskomitees der UdSSR (KGB). Das Lettische Okkupationsmuseum wurde 1993 gegründet.
Es erinnert an die lange verdrängte Geschichte Lettlands: den Staat, sein Volk und das Land unter zwei totalitären Mächten von 1940 bis 1991.
2020 umfasste der Museumsfundus mehr als 70000 Objekte (Dokumente, Fotos, schriftliche, mündliche und materielle Zeitzeugnisse, Gegenstände und Erinnerungsstücke). Museumsmitarbeiter haben mehr als 2400 Videozeugnisse aufgezeichnet – eine der größten Sammlungen zum Phänomen Besatzung in Europa. Die Ereignisse, die über die Menschen in Lettland, Litauen und Estland hereinbrachen, sind ein lebendiges Zeugnis für die Erfahrungen der Völker zwischen zwei totalitären Regimen.
Denkmal „Trauernde Mutter“ auf dem Ehrenfriedhof Inčukalns
Standort: Gemeinde Inčukalns, Inčukalns, Miera-Straße, Friedhof Inčukalns.
Denkmal eingeweiht: 16. Juli 1944. Einweihung nach dem Tod von K. Zāle. Inschrift: Für die gefallenen Partisanen des Vaterlandes 1941 (restauriert). Restaurierung am 5. November 2020. Die Restaurierung erfolgte mit Unterstützung des Regionalrats Inčukalns. Restaurator: Künstler Igors Dobičins.
Ereignisse: „Am 17. Juni 1940 wurde Lettland von der UdSSR besetzt. Am 14. Juni 1941 begannen die Deportationen. Am 22. Juni 1941 griff Deutschland die UdSSR an, und Einheiten der Wehrmacht marschierten in Lettland ein. Die Rote Armee und ihre Unterstützer zogen sich zurück. An vielen Orten in Lettland – darunter Ragana, Sēja und Inčukalns – organisierten sich ehemalige Wachleute und patriotische Jugendliche, um ihre Häuser zu verteidigen und die sowjetischen Besatzer zu vertreiben. Als am 1. Juli 1941 im Viertel „Ziediņi“ (Blumen) der Gemeinde Sēja die Flagge des Freistaats Lettland wieder gehisst wurde, erschossen Spezialeinheiten der Roten Armee die 39-jährige Hausbesitzerin Elza Viša auf dem Nordfriedhof und ihre 64-jährige Mutter Elza Martinova an der Grenze der Gemeinden Sēja und Krimulda. Dies schürte den Hass noch weiter.“ Die Empörung unter den Bewohnern der Gegend führte dazu, dass sie sich in der Volkswiderstandsbewegung zusammenschlossen und Selbstverteidigungseinheiten bildeten, die auch als erste Partisanen bezeichnet wurden (Anführer der Gruppe Inčukalns war Maksis Cālītis). Zu den Kämpfern der Region schlossen sich auch Soldaten und Offiziere des sogenannten Lettischen Territorialkorps an, die aus dem Militärlager Litene geflohen oder freigelassen worden waren. Wenige Tage später, am 4. Juli, kam es zu einem bewaffneten Zusammenstoß mit den Roten, bei dem sieben Soldaten und der Sohn des Apothekers aus Ragana, Pēteris Prašķēvičs, fielen. Außerdem wurde der 17-jährige Schüler des Pädagogischen Instituts Rēzekne, Jānis Porietis, in der Schlacht von Ragana verwundet und gefangen genommen. Er wurde gefoltert, erschossen und in der Nähe von Straupe begraben.
Hier in Inčukalns wurde ein gemeinsames Brudergrab ausgehoben, zu dem die Särge aus weißen, ungehobelten Brettern einzeln in acht Pferdekutschen gebracht wurden, damit die gefallenen Helden in ihrer Heimat beigesetzt werden konnten. Wenige Monate später, bereits während der deutschen Besatzung, wurde auf dem Friedhof ein Denkmal errichtet, das von Kārlis Zāles entworfen worden war (der brillante lettische Bildhauer hatte Inčukalns von 1939 bis zu seinem Tod am 19. Februar 1942 aufgrund einer schweren Krankheit als Wohnort gewählt). Es zeigte eine trauernde Mutter auf einem Rosenstrauch. In den 1950er Jahren sprengten lokale kommunistische Aktivisten das Denkmal. Es blieb beschädigt und unbeweglich bis zur Erweckungsbewegung Ende der 1980er Jahre, als immer mehr Menschen Interesse an den Ereignissen vom 4. Juli 1941 zeigten und die Restaurierung des Kārlis-Zāles-Denkmals forderten. Diese Forderung wurde am 8. September 1988 bei einer Versammlung von Bürgern und Behörden in der Grundschule von Inčukalns erhoben. An der Versammlung nahmen nicht nur die Einwohner von Inčukalns, sondern auch Einwohner umliegender Gemeinden sowie Mitglieder des Umweltschutzclubs und des Lettischen Nationalen Kommunistenverbands aus Riga teil.
… Die Einwohner von Inčukalns beteiligten sich aktiv an der Restaurierung des Denkmals – Teodors Ildens, Arvīds Blaus, Pēteris Vorfolomējevs … und viele andere Patrioten. Am 4. Juli 1989 wurde das wiederhergestellte, würdevolle und zugleich traurige Denkmal von Pfarrer Vaira Bitēna in einer feierlichen Zeremonie geweiht.
General Karls Goppers Memorial Room in seinem Geburtshaus „Makati“
Gelegen in der Gemeinde Plāņi am Ufer des Flusses Vija.
Der Gedenkraum von General Kārlis Goppers in seinem Geburtsort "Maskati" kann besichtigt werden.
Der Bauernhof „Maskatu“ wurde von General Goppers’ Bruder Augusts Goppers geführt, da der talentierte Kriegsführer durch wichtige Ereignisse und die Weltkriege stark beansprucht war. 1920 kehrte der General nach Lettland, in seine Heimat, zurück. Doch viele verantwortungsvolle Aufgaben hielten ihn in Riga gefangen. Augusts bewirtschaftete „Maskatu“ weiterhin. 1940 wurde General Goppers verhaftet und am 25. März 1941 in den Kellern der Tscheka erschossen. 1944 floh die Familie Gopper mit drei Pferdekutschen nach Kurland. Der Krieg spaltete die Familie, und Aleksandrs Goppers’ Töchter – Biruta, Elza und Anna – blieben in Lettland. Ihnen wurde die Rückkehr nach „Maskatu“ verwehrt. Die Häuser waren groß und gut gepflegt. Drei oder vier Familien von Neuankömmlingen wurden dort in separaten Zimmern untergebracht. In der großen Scheune wurde ein Pferdehof eingerichtet. Aufgrund von Streitigkeiten brach 1980 ein Feuer aus. Die Scheune und der große Schuppen brannten nieder. Zum Glück griff das Feuer nicht auf das Haus über, die Flammen wurden von großen Bäumen zurückgehalten, die unsere Vorfahren gepflanzt hatten.
Nach dem wundersamen Erwachen im Jahr 1991 wurde der lettische Staat zum zweiten Mal wiedergeboren. 1992 erhielt die Familie von General Goppers Bruder August „Maskatus“ als heilige Stätte ihrer Vorfahren zurück. Zehn Jahre lang arbeiteten alle unermüdlich daran, die Häuser vor der Zerstörung zu bewahren, die zerstörten Gebäude zu restaurieren und wiederaufzubauen und den gesamten Hof „Maskatus“ zu verschönern. Die Häuser wurden in ihrem alten Aussehen wiederhergestellt, und ein Gedenkraum für General Kārlis Goppers wurde eingerichtet. Der Gedenkraum kann nach vorheriger Anmeldung unter +371 29396870 oder +371 29254285 besichtigt werden.
Denkmal für die Teilnehmer der Widerstandsbewegung in Stompaki
Das Hotel liegt 15 km von Balvi entfernt in Richtung Viļaka, auf der rechten Straßenseite.
Ein Gedenkschild ist sichtbar.
Am 11. August 2011, dem Gedenktag der lettischen Freiheitskämpfer, wurde an der Straße Balvu-Viļakas gegenüber dem Stompaku-Sumpf ein Denkmal für die Teilnehmer der Widerstandsbewegung enthüllt. Es ist den nationalen Partisanen von Pēteris Supe gewidmet, die in den Kämpfen vom 2. und 3. März 1945 gefallen sind. Ende Juli wurde eine Zeitkapsel mit einer Botschaft für zukünftige Generationen in das Fundament des Denkmals eingelassen. In der Kapsel befindet sich ein Dokument mit den Namen von 28 nationalen Partisanen, die in den Kämpfen vom 2. und 3. März 1945 gefallen sind.
Im Februar 1945 wurde auf den Inseln des Stompaku-Sumpfes, die die Bevölkerung bald als Stompaku-Sumpfinseln bezeichnete, zwei Kilometer von der Straße Balvi-Viļaka entfernt, das größte Partisanenlager Lettlands errichtet. Dort lebten 360 Menschen in 22 Unterständen. Unter ihnen befanden sich auch Legionäre, die nach dem Rückzug ihrer Division mit all ihren Waffen im Haus ihres Vaters geblieben waren. Um die Partisanen zu vernichten, griffen Soldaten zweier Tscheka-Bataillone am 2. März 1945 die Unterstände zusammen mit Panzerabwehrkanonen an, die auch über vier Mörser verfügten. Die Kämpfe dauerten den ganzen Tag. Die Partisanen leisteten hartnäckigen Widerstand, und die Angreifer erlitten schwere Verluste, sodass sie das Lager nicht einnehmen und die Partisanen nicht vernichten konnten. 28 Bewohner des Stompaku-Sumpfes fielen in der Schlacht oder starben an ihren schweren Verletzungen. In der folgenden Nacht gelang es den Partisanen schließlich, das Lager zu durchbrechen. „Belagerung und unbesiegt zurückgelassen“ – so schreibt Zigfrīds Berķis, Vorsitzender der Kommission für die Angelegenheiten der Teilnehmer der Nationalen Widerstandsbewegung in der Auszeichnungsabteilung, über die Schlacht von Stompak.
Denkmal für den Kommandanten der nordöstlichen nationalen Partisanen Pēteris Supe - "Cinītis"
Zum Gedenken an den Partisanenführer Pēteris Supe wurde am 28. Mai 2005 in Viļaka ein Denkmal enthüllt. Es befindet sich in der Nähe der katholischen Kirche von Viļaka, am Rande der während des Krieges ausgehobenen Schützengräben, in denen die Tschekisten die erschossenen Partisanen bestatteten. Unter dem Denkmal für P. Supe liegt eine Kapsel mit den Namen von 386 gefallenen Partisanen, Beschreibungen von Schlachten und Informationen über den Partisanenführer. In den Stein ist die Inschrift eingraviert: „Dir, Lettland, blieb ich bis zu meinem letzten Atemzug treu.“
Das Denkmal wurde von Pēteris Kravalis entworfen.
In der Nähe befindet sich ein Denkmal für die lettischen Freiheitskämpfer, die im Stompaku-Wald und an anderen Schlachtorten fielen und in den Jahren 1944-1956 von den Tschekisten ermordet wurden.
Am 20. Juni 2008 wurde an der rechten Wand eine Granittafel enthüllt, auf der die Namen von 55 gefallenen Partisanen in drei Spalten angeordnet waren.
Das Denkmal wurde an der Stelle errichtet, an der die kommunistischen Besatzungsbehörden einst die Überreste ermordeter Partisanen zur Schau gestellt hatten, um die übrige Bevölkerung einzuschüchtern.
Auf der angrenzenden Gedenktafel sind Dankesworte an Pēteris Supe und ein Gedicht von Bronislava Martuževa eingraviert:
"Steh auf, Peter Supe,
Seele, kämpfe im Krieg!
Heute ist euer Blutopfertag.
Auferstanden unter dem Volk.
Geh hinaus und lebe für immer!
In der Kraft und Tatkraft der Jugend,
Es flattert, flattert, flattert
"In der aufgehenden Flagge!"
Private Ausstellung „Räume von Abrene“
Die Ausstellung „Räume von Abrene“ befindet sich in der Stadt Viļaka, in einem Gebäude mit einer wechselvollen Geschichte. Anfangs befand sich das Gebäude auf dem alten Marienhausen-Marktplatz, später beherbergte es Wohnungen, Büros und verschiedene Geschäfte, und während des Zweiten Weltkriegs war es das Hauptquartier der lettischen Selbstverteidigung, der Gestapo und der Tscheka. Mehrere Ausstellungen zeigen verschiedene Ereignisse und historische Abschnitte in der Stadt Viļaka und ihrer unmittelbaren Umgebung zwischen 1920 und 1960, als Viļaka Teil des Kreises Abrene von Neu-Lettgallen war. Sie zeigen Gegenstände aus dem Partisanenhauptquartier im Stompaku-Sumpf, die mit der nationalen Partisanenbewegung in Lettgallen in Verbindung standen. Außerdem gibt es Dokumente und Fotos aus dem Unabhängigkeitskrieg. Die neueste Ausstellung ist der einst berühmten Motocross-Strecke „Baltais briedis“ gewidmet.
Gedenktafel für die nationalen Partisanen von Veclaicene am Standort des Bunkers
Liegt in der Gemeinde Veclaicene, Region Alūksne.
Eröffnet am 4. Oktober 2019. Steinmetz Ainārs Zelčs.
Am 13. März 1953 entdeckten die Tschekisten in den Wäldern von Veclaicene in der Nähe der Häuser von "Koruļi" einen sorgfältig getarnten Bunker und verhafteten Bernhards Ābelkoks und Elmārs Tortūz.
Im Bunker wurden Waffen gefunden: 2 deutsche Gewehre und 95 Patronen, 2 „Parabellum“-Pistolen und 152 Patronen.
Am 11. November 1949 erschossen Tscheka-Agenten K. Dokti-Dokteniekus, woraufhin sich seine Gruppe auflöste. Nach dem Anschlag versteckten sich B. Ābelkoks und E. Tortūzis einige Zeit in einem Bunker nahe der Häuser in „Maskaļi“. Ab Frühjahr 1951 errichteten sie mit Unterstützung von Ilona Ābolkalna einen Bunker in „Koruļi“, wo sie bis zu ihrer Verhaftung lebten.
Gedenkstätte des Bunkers der nationalen Partisanengruppe „Jumba“
Gelegen in der Gemeinde Ziemers, im 66. Block des Staatswaldes.
Das Denkmal wurde am 10. Juli 2020 eröffnet.
In der zweiten Phase der lettischen Partisanenbewegung, Mitte 1948, spaltete sich eine Gruppe von vier Personen – Viks Pētersi, Stebers Rolands, Bukāns Ilgmārs und Kangsepa Elvīra – im Gebiet der Pfarreien Mālupē-Beja von der Einheit J. Bitāns-Liepačs ab und begann in den Pfarreien Ziemera-Jaunlaicene-Veclaicene eigenständige Aktivitäten. Das Partisanenhauptquartier befand sich nahe der estnischen Grenze, unweit der Autobahn Riga-Pskow, auf einem Hügel in einem gut ausgebauten Bunker.
Am 2. März 1950, als die Tschekisten den Bunker entdeckten, versteckten sich die Partisanen in einer aus Steinen errichteten Scheune im Haus „Napke“ auf estnischer Seite. Nach einem langen und heftigen Feuergefecht gelang es den Tschekisten am 3. März 1950, die Scheune in Brand zu setzen. Ilgmārs Bukāns, Rolands Stebers und Elvīra Kangsepa verbrannten zusammen mit ihrer neugeborenen Tochter. Pēteris Viks sprang aus dem Fenster der Scheune und versteckte sich auf dem Dachboden des Hauses, wo er gefunden und erschossen wurde. Der Bauernhof brannte nieder. Die Leichen aller gefallenen Partisanen wurden nach Alūksne gebracht. Anfang der 1990er Jahre wurde an der Stelle, wo die Kämpfer starben, eine Gedenktafel errichtet. Elvīra Kangsepas Tochter, die in der brennenden Scheune geboren wurde, erhielt den Namen Liesma.
Gedenkstein in Ilzene in der Nähe der Häuser „Sarvi“ und „Meļļi“.
Gelegen in der Gemeinde Ilzene, Stadt Alūksne.
Der Gedenkstein wurde am 28. September 2018 enthüllt. Steinmetz Ainārs Zelčs.
Die Bewohner dieser Häuser in der Gemeinde Ilzene unterstützten ab Herbst 1944 die von Voldemars Anderson („Vecs“) angeführten nationalen Partisanen, deren Bunker sich in der Nähe im dichten Wald befand. Am 23. November 1945 wurde der Bunker von NKWD-Soldaten umstellt. Neun Kämpfer starben in dem Gefecht. Anschließend wurden zwei Maschinengewehre, 14 automatische Gewehre, elf Gewehre, zehn Pistolen, 3.500 Patronen, 45 Handgranaten und vier Ferngläser sichergestellt. Die Zerschlagung von Voldemars Andersons Gruppe war in der Tscheka-Operation „Kette“ („Цепь“) dokumentiert.
Die Gruppe bestand aus Voldemārs Pāvels Andersons („Vecais“), Gastons Dzelzkalējs, Voldemārs Tonnis, Centis Eizāns, Osvalds Kalējs, Jānis Koemets, Stāvais („Polis“), Voldemārs Rappa, Eduards Rappa und Elmārs Rappa (blieben am Leben).
Gedenkmuseum-Deportationswaggon am Bahnhof Skrunda
Zur Erinnerung an die sowjetischen Deportationen vom Juni 1941 und März 1949 wurden am Bahnhof Skrunda ein Gedenkstein und ein vierachsiger Eisenbahnwaggon als Gedenkmuseum für die Verschleppten errichtet. Es handelt sich hier um den ersten Waggon in Lettland, in dem eine ständige Ausstellung eingerichtet wurde. Sie umfasst Fotos, Briefe, Zeitzeugenberichte und Dokumente der vom Bahnhof Skrunda aus Deportierten sowie verschiedene von ihnen selbst hergestellte Gebrauchsgegenstände. Der Bahnhof Skrunda war eine Sammelstelle für die zur Deportation bestimmten Menschen, eine der drei Bahnstationen des Kreises, zu der Einwohner sowohl aus Skrunda als auch aus der Umgebung von Kuldīga gebracht wurden. 1941 wurde auch die Familie von Guntis Ulmanis, dem ersten Präsidenten der wiederhergestellten Republik Lettland, von hier aus nach Sibirien in die Region Krasnojarsk verbracht.
Gedenkstein für die nationale Parteigruppe von Rihards Pārups
Das Gebäude befindet sich in der Rigaer Straße in der Nähe der Krustpilser Lutherischen Kirche.
Am 22. September 1996 wurde in Krustpils ein Gedenkstein für Rihards Pārups und die von ihm geführte nationale Partisanengruppe enthüllt. Der Gedenkstein wurde vom Bildhauer Ilgvars Mozulāns geschaffen und von der Parlamentspräsidentin Ilga Kreituse finanziell unterstützt. Die Veranstaltung wurde vom Vorstand des Lettischen Nationalen Partisanenverbandes organisiert.
An die nationalen Partisanen von Rihards Pārup,
die von einer Spezialeinheit der Tscheka ermordet wurden
Richard Parups (1914 – 2. Juli 1946)
Gruppenkommandeur
Richard Stulpins (1923 – 1946. 2. VII)
Alberts Avotiņš (1912 – 2. Juli 1946)
Erik Juhna (1928 – 2. Juli 1946)
Aleksandrs Lācis (1919 – 2. Juli 1946)
Peter der Bär (1921 – 1946, 2. Juli)
Jānis Ēvalds Zālītis (Āboliņš) (1911 – 1946, 2. Juli)
Siegfried Bimstein, Theodore Schmidt (… – 2. Juli 1946)
Uldis Šmits (... - 1946. 2. VII)
Peter Lazdans (1926 – 1947)
Erik Konval (1929 – 1947. VI)
Niklāss Ošiņš (1908 – 12. Oktober 1954) – in Riga hingerichtet
Alberts ħiķauka (1911 – 1972 II) – inhaftiert im Mordwinischen Lager
Rihards Pārups wurde am 11. Juni 1914 in Kaķīši, einem Ortsteil der Gemeinde Krustpils, geboren. Im Zweiten Weltkrieg diente er als Sergeant in der Panzerabwehrdivision der 15. Lettischen Division. Er beteiligte sich an Partisanenaktionen in den Gebieten Jēkabpils und Madona und war Mitglied der Nationalen Widerstandsbewegung sowie Anführer einer Einheit in diesen Gebieten. Rihards Pārups fiel am 2. Juli 1946 in der Gemeinde Vietalva im Kampf gegen Tscheka-Truppen. Sein Grab ist leider unbekannt. Eine Gedenktafel erinnert auf dem Friedhof der Rigaer Brüder an ihn. Im Herbst 1945 wurde im Bezirk Jēkabpils unter der Führung von R. Pārups eine Partisanengruppe gegründet. In ihrer kurzen Existenz war sie an über zwanzig bewaffneten Auseinandersetzungen mit Einheiten des damaligen Innenministeriums beteiligt. Der Bericht des Tscheka-Oberst Kotow an die Rigaer Führung besagt, dass die Aktivitäten der Sowjetregierung in den Bezirken Jēkabpils und Madona infolge der Aktionen der Gruppe während dieser Zeit praktisch lahmgelegt waren. Die von R. Pārup angeführten nationalen Partisanen fanden und vernichteten mehrere Deportationslisten und retteten so vielen Menschen das Leben. Da die Führung des Sicherheitskomitees die nationale Partisaneneinheit nicht in offener Kampfhandlung besiegen konnte, infiltrierte sie diese mit vier Angehörigen der Tscheka-Spezialeinheit. Diese erschossen zehn Partisanen der Einheit, darunter R. Pārup. 1947 wurden zwei weitere in der Nähe von Jaunkalsnava erschossen, und 1951 ein Mitglied dieser Einheit. Nach 25 Jahren Zwangsarbeit in einem mordwinischen Lager starb der 14. Partisan der von R. Pārup angeführten Gruppe wenige Tage vor der Befreiung.
Historische Ausstellung „Das Feuer des Gewissens“
Die historische Ausstellung „Das Feuer des Gewissens“ befindet in der Nähe des Schlossplatzes von Cēsis. Sie wurde in den Arrestzellen für Untersuchungshäftlinge aus der Sowjetzeit eingerichtet und informiert über die Okkupation Lettlands und über erstaunliche und mutige Beispiele des individuellen Widerstandes. Im Hof trägt eine Mauer des Gedenkens die Namen von 643 Einwohnern des ehemaligen Kreises Cēsis, die der sowjetischen Verfolgung zum Opfer fielen: Menschen, die 1941 oder 1949 deportiert wurden sowie erschossene oder zum Tode verurteilte nationale Partisanen. Eine Zeittafel veranschaulicht die Abfolge der Ereignisse in den Besatzungsjahren von 1939 bis 1957. Thematisch geordnete Ausschnitte aus Lokalzeitungen stellen die politische Propaganda beider Besatzungsregime gegenüber. Die sechs Arrestzellen für Untersuchungshäftlinge sind etwa in dem Zustand von 1940/41 und – wie in den Nachkriegsjahren üblich – erhalten. Hier waren Einwohner des Kreises Cēsis wegen verschiedener antisowjetischer Aktivitäten für einige Tage inhaftiert, deren Voruntersuchungen und Verhöre hier stattfanden, bevor sie in die Tscheka (KGB)-Zentrale nach Riga überstellt wurden, darunter nationale Partisanen, Partisanenunterstützer, Jugendliche, die „antisowjetische“ Flugblätter verteilt hatten und andere sog. „Vaterlandsverräter“. Hier ist alles original erhalten - die Arrestzellen nebst den mit Essens-Durchreichen ausgestatteten Eisentüren, Holzpritschen, ein Häftlingsklo, eine kleiner Küchenraum mit Herd und die typischen ölgestrichenen Wände der Sowjetzeit.
2019 gewann die Ausstellung den dritten Platz im alljährlichen nationalen Designwettbewerb Lettlands.
Hotel Viru und KGB-Museum
Das Hotel Viru in Tallinn wurde 1972 erbaut. Das für ausländische Gäste konzipierte Hotel musste dabei auch den Anforderungen der sowjetischen Sicherheitsorgane – des KGB – entsprechen.
In der Ausstellung des Museums geht es um weit mehr als ein Hotel und den KGB. Das Museum ist eine Fundgrube für Geschichten aus zwei Welten. In der einen, der propagandistisch überhöhten, die hauptsächlich auf dem Papier existierte, lebten glückliche Sowjetmenschen in Überfluss und freundschaftlicher Verbundenheit, unter der Führung einer klugen Einheitspartei, ohne Unfälle oder Katastrophen. In der anderen Welt, dem realsozialistischen Alltag, war das Leben weitaus differenzierter und schwieriger.
KGB-Gefängniszellen
Das Museum befindet sich im Kellergeschoss des ehemaligen NKWD/KGB-Hauptquartiers im Zentrum Tallinns.
Während der sowjetischen Besatzungszeit befand sich im Keller des Gebäudes in der Pagari-Straße 1 eines der berüchtigtsten und gefürchtetsten Untersuchungsgefängnisse des Landes. Hier wurden estnische Politiker, Staatsbeamte, Intellektuelle, Veteranen des Freiheitskrieges und viele andere Menschen gefoltert und zum Tode oder zu Gefängnisstrafen verurteilt. Die Kellerzellen sind bis heute ein Symbol des kommunistischen Terrors und sind nun der Öffentlichkeit zugänglich. Zu sehen sind ein Keller mit zwei Gängen, sechs Zellen und eine Arrestkammer. Die Dauerausstellung "KGB (m)aja lugu" erzählt die Geschichte der dort begangenen Verbrechen.
Das Haus in der Pagari-Straße 1 indes hat eine lange Geschichte. Das 1912 als Wohnhaus errichtete Gebäude war später Sitz der provisorischen Regierung der Republik Estland. Von hier aus wurde der Freiheitskrieg angeführt. Bis 1940 beherbergte das Gebäude das Kriegsministerium Estlands. Ab März 1991 wurde das Gebäude von der estnischen Polizei genutzt. Heute ist es wieder mit Wohnungen belegt.
KGB-Museum in Tartu
Das Museum befindet sich an der Kreuzung von Riia- und Pepleri-Straße in Tartu.
Es gehört zur Riege der Historischen Museen der Stadt Tartu. Das Museum befindet sich im "grauen Haus" auf dem Rigaer Berg, wo der NKWD/KGB in den 1940er und 1950er Jahren seinen Sitz hatte. Das Untergeschoss des Gebäudes, wo sich das Untersuchungsgefängnis für aus politischen Gründen Inhaftierte befand, ist für Besucher zugänglich. Einige der Zellen, die Arresträume und der Korridor wurden in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt. In den anderen ehemaligen Gefängniszellen ist eine Ausstellung zu sehen, die einen Überblick über den Zweiten Weltkrieg, die Freiheitsbestrebungen im Estland der Nachkriegszeit, die Verbrechen des kommunistischen Regimes und das Leben im Untersuchungsgefängnis gibt. Die Idee für das Museum stammt von ehemaligen Mitgliedern der in Tartu ansässigen studentischen Widerstandsbewegung "Sini-Must-Valge", die bei einem Besuch ihrer eigenen damaligen Gefängniszellen feststellten, dass es nicht allzu schwierig sein würde, das einstige Aussehen des Gefängnistraktes wiederherzustellen. Das Museum wurde am 12. Oktober 2001 offiziell eröffnet.
Zugehörige Geschichten
Über die nationale Partisanengruppe von D. Breikšs
Die Gedenkstätte wurde an der Stelle der ehemaligen Häuser „Daiņkalni“ und „Graškalni“ in der Gemeinde Rauna errichtet, unter denen sich von 1950 bis 1952 eine Gruppe nationaler Partisanen unter der Führung von Dailonis Breikšis (Spitzname Edgars, 1911-1952) in Bunkern versteckte.
Waldtochter Domicella Zwerg (Lucia)
Domicella Pundure ist 90 Jahre alt. Am 3. Mai 2018 erhielt sie auf Schloss Riga von Präsident Raimonds Vējonis den Viesturas-Orden für ihre besonderen Verdienste im nationalen Widerstand und bei der Verteidigung der Unabhängigkeit des Landes. Domicella Pundure ist die letzte Augenzeugin der Schlacht im Stompaku-Sumpf.
Pēteris Supe – Initiator der Gründung des Lettischen Nationalen Partisanenverbandes
Von 1944 bis 1946 gelang es Pēteris Supe, die in den Wäldern verstreuten nationalen Partisaneneinheiten zu einer organisierten Bewegung zu vereinen, die den Kampf gegen die Besatzung Lettlands im Kreis Abrene noch mehrere Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg fortsetzte. Pēteris Supe, genannt „Cinītis“, war einer der herausragendsten Organisatoren und Anführer der nationalen Partisanenbewegung in Nordlatgale.
Über das Eckhaus
Die Erzählerin beschreibt ihre ersten Eindrücke bei ihrer Ankunft im Corner House. Die Erinnerungen offenbaren die harten Lebensbedingungen der Gefangenen.
Erinnerungen an die KGB-Zellen in Tartu
Ülo Raidma, ein Mitglied der studentischen Widerstandsorganisation Blau-Schwarz-Weiß, erinnert sich an seine Zeit in den Zellen.