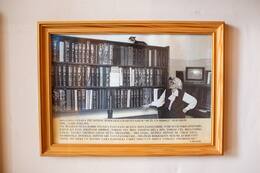Totalitarismus
II Zweiter Weltkrieg, IV Die sowjetische Besatzung und der Kalte Krieg
Totalitarismus (von lateinisch totalis „allumfassend“; englisch Totalitarianism, deutsch Totalitarismus, französisch totalitarisme, russisch тоталитаризм) – ein politisches System, in dem der Staat ohne öffentliche Beteiligung regiert wird. Entscheidungen werden ohne Abstimmung mit der Mehrheit der Gesellschaft getroffen; die wichtigsten sozialen, wirtschaftlichen und politischen Aktivitäten werden in einem totalitären Regime vom Staat kontrolliert. Es handelt sich um eine Form der Diktatur, in der die Macht einer Person in allen Bereichen eingeschränkt ist. Unter den Bedingungen einer Diktatur liegt die Macht bei einem kleinen Personenkreis oder sogar bei einer einzelnen Person. Charakteristische Merkmale: Die Staatsmacht ist in den Händen einer kleinen Gruppe – einer Clique – konzentriert; Unterdrückung der Opposition; allgemeiner Terror als Instrument der Staatsführung; Unterordnung aller Lebensbereiche unter die Interessen des Staates und die herrschende Ideologie; permanent mobilisierte Gesellschaft durch Personenkult, Massenbewegungen, Propaganda usw.; aggressive, expansionsorientierte Außenpolitik; vollständige Kontrolle über das öffentliche Leben.
Die Periode totalitärer Regime in Lettland lässt sich chronologisch in drei Abschnitte unterteilen: 1) die erste Besetzung durch die UdSSR vom 17. Juni 1940 bis Juli 1941; 2) die Besetzung durch Nazi-Deutschland von Juli 1941 bis Herbst 1944 (in Kurland bis Mai 1945); 3) die Periode der zweiten sowjetischen Besetzung vom Herbst 1944 bis zum Tod Stalins im Jahr 1953.
Der Begriff Totalitarismus wurde von dem italienischen antifaschistischen Publizisten Giovanni Amendola geprägt. 1925 übernahm der italienische Ministerpräsident und Diktator Benito Mussolini den Begriff, und die Faschisten begannen, ihn als Bezeichnung für ihr politisches System zu verwenden. Von den italienischen Faschisten wurde die Idee des „Totalitarismus“ von deutschen Intellektuellen der Rechten, wie dem Philosophen Carl Schmitt, einem Kritiker des Liberalismus und des liberalen Staates, übernommen.
In der Wissenschaft wird darüber debattiert, welche Regime als totalitär gelten können. Es herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass die Regime des 20. Jahrhunderts im nationalsozialistischen Deutschland (1934–1945), in der UdSSR unter Jom Stalin (1929–1953), in China unter Mao Zedong (1949–1976), in der Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea) unter der Kim-Dynastie (1948–heute) und unter Pol Pot in Kambodscha (1976–1979) als totalitär einzustufen sind. Die Meinungen über andere Länder oder andere Zeiträume in den genannten Ländern gehen auseinander.
Weitere Informationsquellen
Daina Bleiere. Totalitarismus. Nationale Enzyklopädie. https://enciklopedija.lv/skirklis/51186
Totalitarismus. Wikipedia. https://lv.wikipedia.org/wiki/Totalit%C4%81risms
Zugehörige Zeitleiste
Zugehörige Objekte
Lettisches Okkupationsmuseum
Die Museumsausstellung beleuchtet die Geschichte Lettlands von 1940 bis 1991, also die nationalsozialistische und die sowjetische Besatzungszeit.
Das „Haus der Zukunft“ ist ein Projekt des renommierten lettisch-amerikanischen Architekten Gunārs Birkerts zur Renovierung und Erweiterung des lettischen Okkupationsmuseums sowie zur Schaffung einer neuen Ausstellung. Die Ausstellung „Die Geschichte des KGB in Lettland“ befindet sich im sog. Eckhaus, dem ehemaligen Gebäude des Staatssicherheitskomitees der UdSSR (KGB). Das Lettische Okkupationsmuseum wurde 1993 gegründet.
Es erinnert an die lange verdrängte Geschichte Lettlands: den Staat, sein Volk und das Land unter zwei totalitären Mächten von 1940 bis 1991.
2020 umfasste der Museumsfundus mehr als 70000 Objekte (Dokumente, Fotos, schriftliche, mündliche und materielle Zeitzeugnisse, Gegenstände und Erinnerungsstücke). Museumsmitarbeiter haben mehr als 2400 Videozeugnisse aufgezeichnet – eine der größten Sammlungen zum Phänomen Besatzung in Europa. Die Ereignisse, die über die Menschen in Lettland, Litauen und Estland hereinbrachen, sind ein lebendiges Zeugnis für die Erfahrungen der Völker zwischen zwei totalitären Regimen.
Victory Park
Das Gebäude befindet sich in Riga, Pārdaugava, in der Nähe der Nationalbibliothek Lettlands.
Der Siegespark ist einer der größten und umstrittensten Parks Lettlands. Auf einer Fläche von 36,7 Hektar befindet sich das monumentale Ensemble „Den Befreiern Sowjetlettlands und Rigas von den deutschen faschistischen Besatzern“, das die sowjetische Besatzungsmacht verherrlicht. Errichtet auf dem Gelände von Befestigungsanlagen aus dem 17. Jahrhundert, war er der letzte bekannte Ort öffentlicher Hinrichtungen in Lettland.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand auf dem Gelände der ehemaligen Festung Kobrona ein Landschaftspark. Er ist dem russischen Kaiser Peter I. gewidmet, dessen Armee 1710 Riga eroberte. Nach der Gründung des Staates Lettland wurde für das Gelände ein ehrgeiziges Projekt geplant – der Siegespark. Er sollte den Helden des Unabhängigkeitskrieges gedenken und ein Symbol für die Größe und das Selbstbewusstsein des lettischen Staates sein. Der mit öffentlichen Spenden finanzierte Park war für Großveranstaltungen vorgesehen, doch der Zweite Weltkrieg durchkreuzte die Pläne.
Während der sowjetischen Besatzung diente das Parkgelände als Hinrichtungsstätte für sieben deutsche Offiziere. Dies war ein bedeutendes Ereignis im Vorfeld der Eröffnung des größten Denkmals für das Sowjetregime und seine Armee im Baltikum im Jahr 1985.
Bis zum 23.08.2022 (abgebaut) konnte man das monumentale Ensemble besichtigen, das die vorherrschenden Trends im Denkmalbau der Sowjetunion repräsentierte. Die weitläufige Parkanlage eignet sich hervorragend für Spaziergänge und aktive Erholung.
Denkmal für die Freiheitskämpfer
Das Hotel liegt in Tukums, Mālkalns, Jelgavas-Straße 15A.
Das Denkmal wurde 1975 enthüllt, um die Verdienste der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg hervorzuheben. Es diente der sowjetischen Ideologie und Propaganda, stärkte symbolisch die Präsenz des Besatzungsregimes in Lettland und schuf den Mythos der Sowjetmacht als „Befreier“. Der Künstler des Denkmals ist der aus Tukums stammende Bildhauer Arta Dumpe.
Nach der Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945 betrachtete die Rote Armee Kurzeme als vom Feind erobertes Gebiet, nicht als befreiten Teil der UdSSR. Die Einwohner Kurzemes galten als Feinde, und ihr Eigentum wurde als Kriegsbeute betrachtet. Die repressiven Behörden und die Armee begannen mit der „Säuberung“ Kurzemes. Männer zwischen 16 und 60 Jahren wurden festgenommen, registriert und überprüft. Hinsichtlich der Gefährlichkeit wurden die Männer Kurzemes mit dem Militärpersonal des kapitulierten Deutschlands gleichgesetzt. Die Nachsicht der Roten Armee und eine Welle von Verbrechen – Morde, Vergewaltigungen, Raubüberfälle, Verhaftungen und das Verschwindenlassen von Menschen – setzten ein. Bewaffneter Widerstand kam einzig von den Partisanengruppen. Die sowjetischen Behörden stellten Zerstörerbataillone auf, unter anderem im Bezirk Tukums, um jegliche Opposition zu eliminieren. Die Welle der Gewalt und des Terrors erreichte 1949 ihren Höhepunkt mit den Deportationen der Bevölkerung in ganz Lettland.
Das Denkmal ist heute noch zu besichtigen. Seine symbolische Bedeutung wurde auf verschiedene Weise interpretiert – von einer Schlachtszene bis hin zu einer Mutter, die ihre auf gegnerischen Seiten kämpfenden Söhne im Arm hält. Das Denkmal steht auf einem Hügel und bietet einen spektakulären Ausblick.
Private Militärsammlung in Mundigciems
Private Militärsammlung in Mundigciems. Aivars Ormanis sammelt seit vielen Jahren historische Gegenstände - Militäruniformen, Uniformen, Tarnungen, Kommunikationsgeräte, Haushaltsgegenstände, Schutzausrüstungen aus verschiedenen Epochen und Ländern, die auf den Zweiten Weltkrieg, die Sowjetarmee und die Wiederherstellung des unabhängigen Lettlands zurückgehen.
Die Sammlung wird derzeit nicht gut gepflegt und die Exponate sind in einer ehemaligen Scheune einer Kolchose untergebracht.
Stadtmuseum Alūksne
Das Stadtmuseum Alūksne befindet sich im Neuen Schloss von Alūksne, einem Architekturdenkmal von nationaler Bedeutung, das Ende des 19. Jahrhunderts im neogotischen Stil erbaut wurde. Das Museum verfügt unter anderem über einen den Opfern des Totalitarismus gewidmeten Gedenkraum, in dem die Schicksale der Bewohner der Region Alūksne in Sibirien und im Fernen Osten dokumentiert werden sowie die historische Ausstellung „Fest der Zeitalter“, die thematisch den Zeitraum von der Urgeschichte bis in die Gegenwart abdeckt. Dabei ist dem Beitrag des 7. Infanterieregiments Sigulda zum militärischen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Region eine besondere Abteilung gewidmet. Das 7. Infanterieregiment Sigulda wurde ab dem 20. Juni 1919 auf dem Gut Naukšēni zusammengestellt. Zunächst wurde eine Kampfgruppe bestehend aus 22 Offizieren und 1580 Soldaten aus dem Reservebataillon der Nordlettischen Brigade gebildet, genannt: Abteilung Dankers. Diese wurde zunächst in das 2. Bataillon des 3. Regiments Jelgava eingegliedert, am 23. August aber, mit der Aufstellung weiterer Kompanien, in das 7. Infanterieregiment Sigulda integriert. Die Einheiten nahmen 1919 an den Kämpfen gegen die Bermondt-Truppen teil und wurden am 5. Januar 1920 an die Front nach Latgale in den Kampf gegen die Bolschewiken geschickt. Nach Abschluss des Friedensvertrages mit Sowjetrussland wurde das Regiment zum Schutz der Ostgrenze Lettlands eingesetzt. Mehr als 200 Soldaten des Regiments ließen im lettischen Unabhängigkeitskrieg ihr Leben, 85 wurden mit dem Lāčplēsis-Orden für militärische Verdienste geehrt. 1921 wurde das 7. Infanterieregiment Sigulda in Alūksne stationiert. Das Neue Schloss von Alūksne diente damals als Hauptquartier des Regiments. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahmen sowjetische Sicherheitsbehörden das Schloss. Ab Ende der 1950er Jahre beherbergte das Schloss verschiedene Kultureinrichtungen: die Kultur- und Kinofizierungsabteilung des Exekutivkomitees, den Pionierpalast, die Bibliothek, ein Kino und das Museum.
Melānija-Vanaga-Museum und sibirische Erdhütte
Das Melānija-Vanaga-Museum ist in der einstigen Dorfschule von Amata (Landkreis Cēsis) untergebracht. Das Museum präsentiert Materialien über das Leben, die dichterische Tätigkeit, die Familiengeschichte und das Lebensschicksal der Schriftstellerin und Kulturhistorikerin Melānija Vanaga: Videoaufnahmen über Sibirien und die dorthin deportierten Letten sowie die nachempfundene sibirische Erdhütte sind wie eine imaginäre Reise in den Verbannungsort der Schriftstellerin - Tjuchtet im Gebiet Krasnojarsk. Aussehen und Einrichtung der Behausung vermitteln einen lebendigen Eindruck vom harten Alltag in der Fremde. Die Erdhütte birgt seltene betagte Gegenstände aus dem Museum in Tjuchtet: ein Gefäß aus Birkenrinde (genannt „Tujesok“), einen Tonkrug („Krinka“ genannt) und eine Petroleumlampe. Das Museum verfügt über Videoaufzeichnungen von Interviews mit politisch Verfolgten aus der Region und achtzehn Figuren aus Melānija Vanagas autobiografischem Buch „Veļupes krastā“. Die virtuelle Ausstellung des Museums „SEI DU SELBST!“ (http://esipats.lv) schildert die Erlebnisse von fünf deportierten Kindern und ihren Eltern, die von den sowjetischen Behörden zu Unrecht des „Vaterlandsverrates“ beschuldigt wurden.
Militärstützpunkt der sowjetischen Armee in Pāvilosta - aktives Erholungszentrum
Während der Sowjetzeit war hier eine Grenzschutzeinheit stationiert, andere Einheiten der sowjetischen Armee - Verbindungsoffiziere und eine Boden-Luft-Raketenbasis - befanden sich einige Kilometer entfernt im Wald. Nach der Unabhängigkeit war dort die lettische Armee stationiert.
Der ehemalige Militärstützpunkt der Sowjetarmee ist heute ein Erholungs-, Freizeit- und Campingzentrum - für die persönliche Entwicklung im Umgang mit der Natur und den Menschen in der Umgebung.
Ein Ort der Erholung und Unterkunft sowohl für Touristengruppen als auch für Familien. Zimmer, Duschen, WC, Kamine, großzügiges Gelände für Aktivitäten, Naturgeräusche. Reservieren Sie im Voraus unter der Telefonnummer +371 26314505.
Gedenkmuseum-Deportationswaggon am Bahnhof Skrunda
Zur Erinnerung an die sowjetischen Deportationen vom Juni 1941 und März 1949 wurden am Bahnhof Skrunda ein Gedenkstein und ein vierachsiger Eisenbahnwaggon als Gedenkmuseum für die Verschleppten errichtet. Es handelt sich hier um den ersten Waggon in Lettland, in dem eine ständige Ausstellung eingerichtet wurde. Sie umfasst Fotos, Briefe, Zeitzeugenberichte und Dokumente der vom Bahnhof Skrunda aus Deportierten sowie verschiedene von ihnen selbst hergestellte Gebrauchsgegenstände. Der Bahnhof Skrunda war eine Sammelstelle für die zur Deportation bestimmten Menschen, eine der drei Bahnstationen des Kreises, zu der Einwohner sowohl aus Skrunda als auch aus der Umgebung von Kuldīga gebracht wurden. 1941 wurde auch die Familie von Guntis Ulmanis, dem ersten Präsidenten der wiederhergestellten Republik Lettland, von hier aus nach Sibirien in die Region Krasnojarsk verbracht.
Karosta, der Militärhafen von Liepāja (die Tour)
Karosta ist das größte historische Militärgebiet im Baltikum und nimmt heute fast ein Drittel des gesamten Stadtgebiets von Liepāja ein. Der ehemalige Kriegshafen ist ein einzigartiger Militär- und Festungsanlagenkomplex an der Ostseeküste, der historisch und architektonisch nicht nur für Lettland außergewöhnlich ist. Zum militärhistorischen Erbe in Karosta gehören die Nordmole, die Nordforts, der Redan-Vorposten, das Gefängnis und der Wasserturm des Kriegshafens, die orthodoxe St. Nikolaus-Marine-Kathedrale sowie die Oskars-Kalpaks-Brücke.
Dauerausstellung des Heimatmuseums Pāvilosta
Das Heimatmuseum von Pāvilosta zeigt die Ausstellung „Pāvilosta – Leben im Sperrgebiet“. Sie informiert über die Gebietsverwaltung, das grenznahe Sperrgebiet, die Fischereikolchose, Kultur und Alltagsleben in den Jahren der sowjetischen Besatzung. Darüber hinaus wurde eine an Emotionen reiche zweisprachige interaktive digitale Ausstellung sowie eine audiovisuelle Installation mit einem Film über Pāvilosta zusammengestellt. Eine neue Ausstellung läuft unter dem Namen „Goldene Sandkörner von Pāvilosta“. Die digitale Ausstellung informiert über die Geschichte und die Entstehung von Pāvilosta sowie die wichtigsten Ereignisse von 1918 bis heute. Dem militärhistorischen Erbe widmet sich der Ausstellungsteil über die lettischen Freiheitskämpfer des Unabhängigkeitskrieges und die Zeit der sowjetischen Besatzung.
Gedenkstein am Bahnhof Stende
Die Eisenbahnlinie Ventspils - Mazirbe sowie die Verlängerung Stende - Dundaga nach Mazirbe mit einer Abzweigung nach Pitrags waren ausschließlich für strategische militärische Zwecke bestimmt. Während des Baus dieser Strecken und auch danach wurde die gesamte Zivilbevölkerung aus der Region evakuiert. Die Hauptaufgabe der Militärbahnen im Gebiet der Irbe-Straße bestand darin, die Küstenverteidigungsstellungen des deutschen Heeres mit Geschützen und Munition zu versorgen.
Diese reinen Militärbahnen verbanden auch die drei wichtigsten Leuchttürme in Oviši, Mikeltornis und Šlītere.
Dennoch wurde bereits in den Jahren des Ersten Weltkriegs auch Personenverkehr betrieben.
Am Bahnhof von Stende befindet sich ein Gedenkstein (1989) für die deportierten Letten der Jahre 1941 und 1949.
Am 30. Oktober 1919 wurde der Bahnhof Stende von bermontischen Truppen besetzt. Am 17. November griffen Soldaten der lettischen Armee unter Führung von K. Šnēbergs den Bahnhof an und vertrieben einen Waggon mit Waffen, Kriegsmaterial und Getreide. Für diese Kämpfe wurden 6 Soldaten mit dem Orden ausgezeichnet: K. Bumovskis (1891-1976), P. Strautiņš (1883-1969), R. Plotnieks (1891-1965), E. Jansons (1894-1977).
Zugehörige Geschichten
Der Deportationszug, heimlich fotografiert in der Nähe des Bahnhofs Skrunda im Jahr 1949
Am 25. März 1949 wurde Elmārs Heniņš, ein Schüler in Skrunda, Zeuge der Verschleppung seiner Klassenkameraden. Er nahm seinen Fotoapparat und kletterte auf eine Kiefer auf einem nahe gelegenen Hügel, um das Geschehen zu dokumentieren, wobei er die Bilder später versteckte.
Aussichtsturm der Küstenwache von Kolka
Versteckt zwischen den letzten Kiefern des Kaps Kolka befindet sich ein Grenzwachturm, in dem sich während der Sowjetzeit ständig ein Grenzposten befand; das kleine Steingebäude daneben ist heute verlassen und verfällt.
Die Schlacht von Dzelzkalni im Zūri-Wald am 23. Februar 1946
Den Winter 1945/46 verbrachte die Gruppe „Brass“ im Wald von Zūri bei Dzelzkalni, wo mehrere Bunker errichtet worden waren. Dort lebten etwa 40 Partisanen. Am 23. Februar 1946 wurde das Lager von Truppen des sowjetischen Innenministeriums umstellt, und es kam zu einem heftigen Gefecht.
Die Gefangennahme der Kabylen um die Wende von 1945 zu 1946
Eine der markantesten Manifestationen des bewaffneten Widerstands in Kurzeme nach dem Krieg war die Einnahme von Kabile an Weihnachten 1945 und die darauffolgende Schlacht in der Nähe des Hauses Āpuznieki am 1. Januar 1946.
Pēteris Čevers - nationaler Partisan und Anführer einer Partisanengruppe
Pēteris Čevera - nationaler Partisan und Kommandeur einer nationalen Partisanengruppe
Die Rolle des ehemaligen Legionsleutnants – Tscheka-Agenten Arvīds Gailītis bei der Liquidierung der Pēteris Čevers-Gruppe
Hauptmann Pēteris Čevers und sieben weitere Partisanen wurden am 1. November 1950 im Engure-Waldmassiv gefangen genommen. Dort befand sich zufällig eine Schein-Partisanengruppe unter der Führung des ehemaligen Legionsleutnants Arvīds Gailītis (Spitzname des Agentenkämpfers: „Grosbergs“) in der Nähe. Ihr gehörten Angehörige der Lettischen SSR-Volksmiliz VDM und Agentenkämpfer an, die sich als „Waldbrüder“ ausgaben.
US-CIA-Fallschirmjäger Leonids Zariņš – von der Tscheka als „für die Rekrutierung ungeeignet“ bezeichnet
Leonid Zariņš wurde in den USA als CIA-Agent angeworben und überquerte 1953 mit einem Flugzeug aus Deutschland die Grenze zur UdSSR. Er sprang mit dem Fallschirm in der Nähe von Auce ab. Unglücklicherweise entpuppte sich einer seiner Kontaktpersonen als Doppelagent, und Leonid wurde kurz darauf verhaftet. Er weigerte sich, mit den Tschekisten zusammenzuarbeiten, und wurde 1954 ohne Gerichtsverfahren erschossen.